Trennungskosten Scheidung und Unterhalt von der Steuer absetzen – geht das?

Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.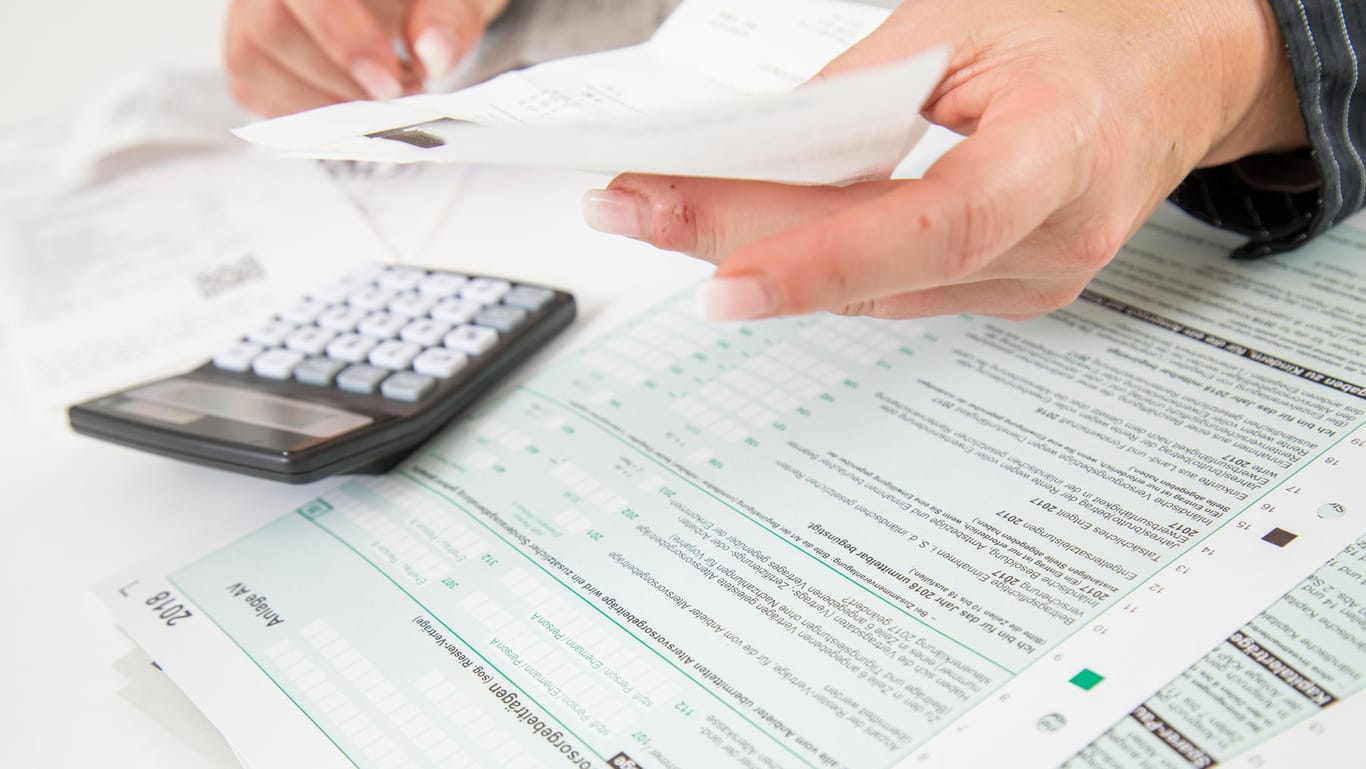

Eine Scheidung löst die Ehe auf – was sich so einfach anhört, kann neben Zeit auch viel Geld kosten. Mitunter lassen sich die Ausgaben aber in der Steuererklärung geltend machen.
Das Ende einer Ehe bedeutet nicht nur das Aus für einen Lebensentwurf, sondern kann auch ordentlich ins Geld gehen. Das gilt erst recht, wenn eine Scheidung vor Gericht landet und Unterhaltszahlungen fällig werden.
Manch einer fragt sich daher, ob er das Finanzamt an diesen Kosten beteiligen kann. Wir zeigen Ihnen, was geht – und was nicht.
Kann ich Scheidungskosten von der Steuer absetzen?
Nein, in der Regel nicht. Was bis 2013 noch möglich war, ist es seitdem nicht mehr: Prozesskosten können Sie nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen. Das gilt auch für die Kosten eines Scheidungsverfahrens, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil vom 18. Mai 2017 (BFH VI R 9/16). Allerdings gibt es eine Ausnahme.
Scheidung: Außergewöhnliche Belastung
Geht es an die existenzielle Lebensgrundlage, lässt sich der Fiskus durchaus erweichen. Sie können also Scheidungskosten steuermindernd als außergewöhnliche Belastung geltend machen, wenn sie sonst lebensnotwendige Bedürfnisse nicht mehr im üblichen Rahmen befriedigen könnten (§ 33 Einkommensteuergesetz (EStG) ).
Kann ich Unterhaltskosten von der Steuer absetzen?
Ja, Sie können Unterhaltskosten von der Steuer absetzen. In welchem Umfang hängt allerdings von der Kooperationsbereitschaft Ihres unterhaltsberechtigten Ex-Partners ab.
Denn entweder machen Sie die Kosten als Sonderausgaben geltend – dafür benötigen Sie die Zustimmung des Unterhaltsempfängers – oder Sie geben Sie als außergewöhnliche Belastung an. Welche Beträge Sie dabei absetzen können und was genau Sie in der Steuererklärung eintragen müssen, lesen Sie in den folgenden Abschnitten.
Wie setze ich Unterhalt als Sonderausgaben ab?
Ist Ihr Ex-Partner einverstanden, können Sie Ihre Unterhaltskosten pro Jahr bis zu einer Summe von 13.805 Euro als Sonderausgaben absetzen. Grundlage ist § 10 Abs. (1a) Nr. 1 EStG. Dafür tragen Sie die Unterhaltskosten in der Anlage U (für das sogenannte Realsplitting) und in der Anlage Sonderausgaben ein.
Der Unterhaltsempfänger muss sein Einverständnis durch eine Unterschrift in der Anlage U erklären. Zudem muss der Ex-Partner die gleiche Summe in der Anlage SO als sonstige Einkünfte aufführen. Teil des Realsplittings ist auch, dass Unterhaltspflichtige die Steuern übernehmen, die auf die Unterhaltszahlungen beim Empfänger anfallen (Freistellungserklärung). Mehr zum Thema Sonderausgaben lesen Sie hier.
Gut zu wissen: Das Steuerformular Anlage U ist nicht zu verwechseln mit der Anlage Unterhalt. Die Anlage U nutzen Sie, wenn Sie die Unterhaltskosten als Sonderausgaben geltend machen wollen, die Anlage Unterhalt, wenn Sie sie als außergewöhnliche Belastung absetzen möchten.
Wie setze ich Unterhalt als außergewöhnliche Belastung ab?
Verweigert der Ex-Partner seine Unterschrift, können Sie die Unterhaltszahlungen bis zu einer Höhe von 10.347 Euro (für das Steuerjahr 2022) als außergewöhnliche Belastungen angeben. Für das Steuerjahr 2023 gilt eine höhere Grenze von 10.908 Euro. Der Höchstbetrag verringert sich, falls der Unterhaltsberechtigte eigene Einkünfte hat.
In der Einkommensteuererklärung tragen Sie die Unterhaltskosten lediglich in der Anlage Unterhalt (nicht Anlage U!) ein. Eine Unterschrift des Unterhaltsberechtigten ist in diesem Fall nicht nötig.
- Eigene Recherche
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- Deutscher Anwaltverein
- Finanztip: "Realsplitting: Anlage U zur Steuererklärung"











 News folgen
News folgen






