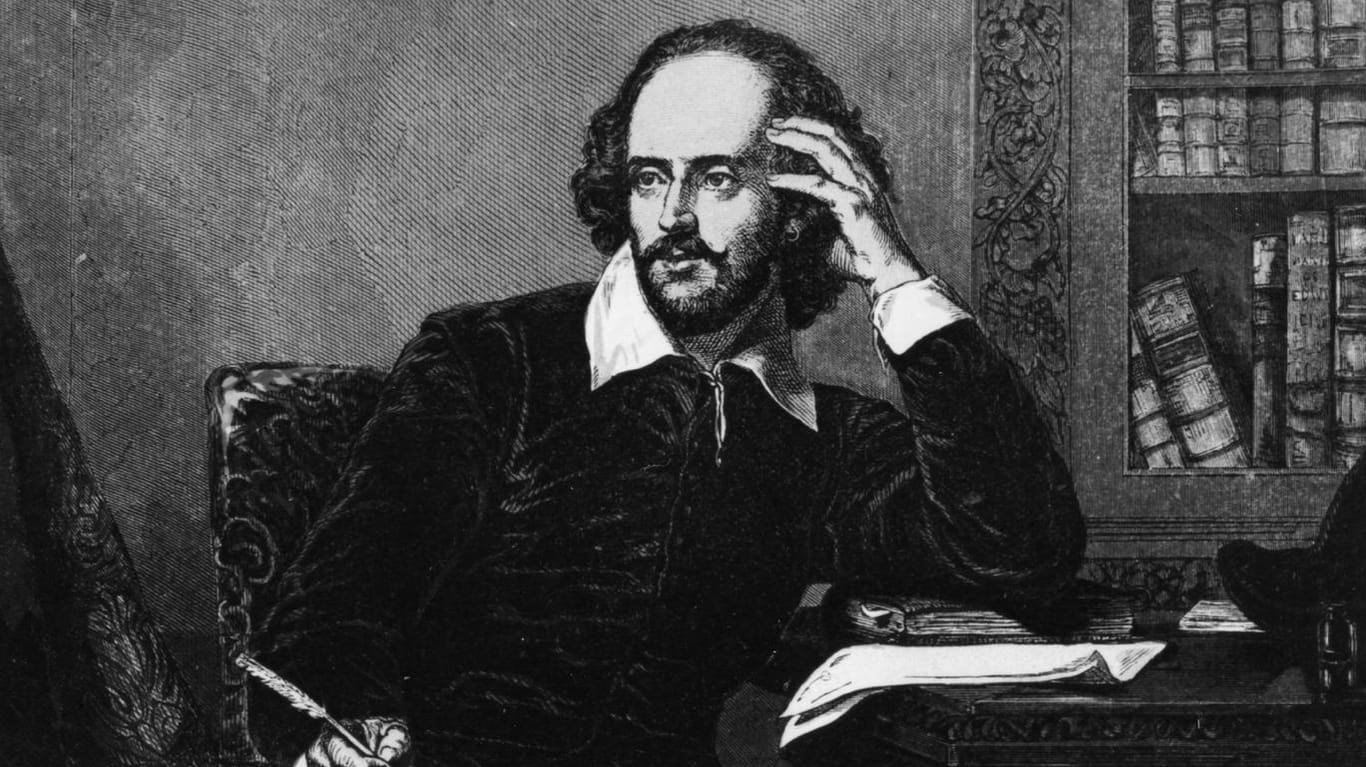Altbundespräsident Joachim Gauck verteidigt sich gegen Kritik

Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.

Altbundespräsident Joachim Gauck spricht über seine Idee von Toleranz. Er warnt vor einer Trotzreaktion, sollte man der AfD intolerant begegnen – und verteidigt sich gegen Kritik.
Joachim Gauck war Oppositioneller in der DDR, Leiter der Stasiunterlagenbehörde und von 2012 bis 2017 als Bundespräsident erster Mann im Staat. Jetzt hat er ein Buch über Toleranz geschrieben – und mit Forderungen nach mehr Toleranz für Rechte direkt eine Kontroverse ausgelöst.
Das Buch erscheint am 18. Juni, vorab sprach der Altbundespräsident mit t-online.de über das Buch, die AfD, seine Haltung zu politischer Korrektheit und der Integration von Flüchtlingen.
Herr Gauck, wann wurde Ihre Toleranz zuletzt herausgefordert?
Joachim Gauck: Die wird dauernd und verstärkt herausgefordert, weil es in der Gesellschaft so viele und so tiefe Widersprüche gibt. Im Moment ärgere ich mich vor allem über einen neuen Nationalismus, den ich für altmodisch und schädlich halte. Wenn wir eine Bewegung haben, die so tut, als wären Nationalstaat und Europa unvereinbar und Europa ein Schaden, dann werde ich zornig – muss mir aber sagen, dass andere das okay finden.
Tut Toleranz weh?
Ja, Toleranz kann wehtun, sie ist oft sogar eine Zumutung. Es gibt beispielsweise Personen und Parteien, deren Ideologie ich ablehne. Mit denen muss ich streiten – im Sinne einer kämpferischen Toleranz. Ich mache sie aber nicht zu Feinden, die zu vernichten sind, sondern behandle sie als Gegner, die ich ernst nehme.
Nennen wir diese Partei beim Namen: die AfD. Die sitzt in Parlamenten und ist nicht verboten. Was heißt kämpferische Toleranz für Sie im Umgang mit der AfD?
Solange diese Partei nicht verboten ist, sollten wir ihren Mitgliedern und Anhängern im Sinne der kämpferischen Toleranz vor allem mit Argumenten begegnen. Nicht hinnehmbar ist allerdings, dass in dieser Partei verkappte Nazis aktiv sind und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geduldet wird. Allerdings schließe ich nicht aus, dass sich die Partei zwar betont national, aber doch demokratisch entwickelt – auch wenn sie für mich immer noch verzopft und retro wäre. So oder so, ich halte es augenblicklich für problematisch, dass man der AfD den Bundestagsvizepräsidenten versagt.
Man kann politisch zum Schluss kommen, dass eine erlaubte Partei Intoleranz vertritt, weshalb Toleranz nicht mehr geboten ist, oder?
Man kann zu diesem Schluss kommen, denn auch Erlaubtes kann selbstverständlich intolerant sein. Im Einzelfall sollte man aber überlegen: Treibt man, wenn man eine ganze Partei aus der kämpferischen Toleranz ausschließt und zu Feinden erklärt, ihre Mitglieder und Anhänger nicht noch weiter in eine Trotzreaktion? In Fällen offenkundiger Intoleranz allerdings, etwa bei völkischen und fremdenfeindlichen Positionen in dieser Partei, haben Demokraten unmissverständlich und entschieden zu widersprechen.
Ein Verbotsverfahren gegen die AfD würde sicher scheitern, aber würde sich Ihre Haltung durch ein Verbot ändern?
Die würde sich drastisch ändern, denn eine verbotene Partei ist nicht mehr Teil des öffentlichen Disputs und kann keine Toleranz mehr erwarten.

Embed
Dem "Spiegel" haben Sie gesagt, es brauche "eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts. Wir müssen zwischen rechts – im Sinne von konservativ – und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden." Dafür gab es viel Kritik. Wie haben Sie es gemeint und wie verstehen Sie die Reaktionen?
Ich plädiere für eine weite Bandbreite des politischen Diskurses. Möglichst viele Menschen sollen sich in einem gemeinsamen Debattenraum wiederfinden können. Die teilweise heftigen Reaktionen auf diese Forderung zeigen mir, dass es einigen gar nicht um Debatten geht, sondern einfach um die Sicherung alter Denkweisen und Milieusicherheiten. Dass Toleranz sehr oft eine Zumutung ist, habe ich mehrfach betont.
Sie widmen der "Intoleranz der Guten", wie Sie die "politisch Korrekten" bezeichnen, mehr Seiten als allen anderen Themen. Warum diese Gewichtung?
Wenn in einem Milieu, das Pluralität und Toleranz auf seine Fahnen geschrieben hat, Intoleranz aufkommt, irritiert mich das. Intolerantes und dogmatisches Vorgehen ist für mich nicht dadurch gerechtfertigt, dass es aus edlen Motiven erfolgt. Auch das politisch Korrekte darf nicht vorschnell Tabuzonen errichten. Es darf auch die gewünschten Verhaltensweisen nicht mit moralischem Übereifer durchsetzen. Dabei fühle ich mich Vertretern einer politischen Korrektheit durchaus nah, weil sie die politische Zivilität fördern wollen. Und was einem nahe ist, schaut man sich besonders kritisch an.
Sie verteidigen im Buch Blackfacing, Zitat: "Unverständlich ist mir, wenn in einer Welt, in der Imagination, Zauber und Verwandlung wie im Theater herrschen, darüber gestritten wird, ob Schauspieler sich schwarz anmalen dürfen. Wie also die Statisten in Verdis 'Aida' oder Mozarts Bösewichte in der 'Zauberflöte' besetzen?".
Wenn Sie sich schon diesen Nebenaspekt herausgreifen: Sich im Theater schwarz anzumalen, war und ist nicht in jedem Fall ein Ausdruck von Diskriminierung. Entscheidend sind die Rollen, die Schwarze entweder wie Shakespeares "Othello" als ernsthaften, tragischen Helden zeigen oder als rassistisch verzerrte, verächtlich gemachte Figur.
Sie kennen die Gegenargumente. Dass man Rollen mit schwarzen Schauspielern besetzen kann. Dass in einer Welt der Imagination, in der selbstverständlich Frauen Männer spielen, es auf die Hautfarbe nicht ankommt. Und vor allem: Dass Blackfacing eine dezidiert rassistische Praxis aus dem 19. und 20. Jahrhundert der USA ist.
Selbstverständlich kann und soll man schwarze Schauspieler einsetzen, wenn sie verfügbar sind. Aber Blackfacing im Falle von Hochkultur kann man doch nicht ernsthaft mit den zweifellos rassistischen Minstrel Shows vor hundertfünfzig Jahren in den USA auf eine Stufe stellen.
Wie gesagt, Sie kennen die Gegenargumente, und Sie ahnen vermutlich, dass es Reaktionen geben wird. Scharfe Kritik, möglicherweise Aufrufe, sich zu entschuldigen. Welche Reaktionen werden Sie als Beleg für Intoleranz deuten und welche als Beispiele kämpferischer Toleranz?
Jeder hat das Recht, mir zu sagen, dass ich irre. Das Buch ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ich verstehe es als Debattenbeitrag. Möglicherweise werde ich insbesondere in Detailfragen in zehn Jahren meine Meinung verändert haben.
Das klingt sehr mild. Im Buch steht: Die Intoleranz der Guten. Warum sind diejenigen, die das anders sehen, in Ihrem Verständnis intolerant und nicht auf kämpferische Art tolerant?
Kämpferische Toleranz lässt andere Meinungen gelten, auch wenn sie sie bekämpft. Die Intoleranz der Guten hingegen schließt andere Meinungen häufig aus dem Diskurs aus oder sucht sogar zu verhindern, dass sie überhaupt geäußert werden: etwa durch Störung von Vorlesungen, den Ausschluss bestimmter Diskussionsteilnehmer oder die Entfernung eines missliebigen Gedichtes. Kämpferische Toleranz verteidigt also die Pluralität, Intoleranz auch der Guten aber schränkt Pluralität ein.
Es habe gegenüber dem politischen Islam und Zugewanderten mitunter zu viel Nachsicht gegeben, schreiben Sie, zu viel falsch verstandene Toleranz. Wie sähe richtige, kämpferische Toleranz für Sie aus?
Ich komme aus der evangelischen Kirche, dort und auch weit darüber hinaus gehörte es sich nicht, offen und kritisch über Probleme und Rechtsverstöße von Migranten zu sprechen. Das halte ich für einen Fehler.
Wie würden Sie ihn beheben?
Indem man Unrecht und Intoleranz offen benennt, auch wenn sie von Migranten herrühren. Ich plädiere dafür, dass man Zugewanderten keine Sonderrechte zubilligt. Wer aufgrund seiner kulturellen Prägung homophob, frauenfeindlich oder antisemitisch ist, darf keine mildernden Umstände erfahren. Das ist falsche Toleranz.
Da geht es ins Private. Im Buch erwähnen Sie auch den Verband Ditib, der von der türkischen Religionsbehörde finanziert wird, oder Moscheegemeinden, die Geld aus Saudi-Arabien bekommen, wo der Wahabismus Staatsreligion ist. Wünschen Sie sich mehr Eingriffe des Staates?
Zu viel Zwang schadet. Der Staat kann sicher nicht alles verhindern, weil wir ja die Kultur und Religion der Zugewanderten nicht löschen wollen, im Gegenteil. Wenn aber Herkunftsländer Personal entsenden oder Finanzströme etwa aus Saudi-Arabien fließen, ist das sicher problematisch. Vor allem, wenn damit ein fundamentalistischer Islam oder eine antiwestliche Ideologie gefördert werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Transparenz. Am besten wäre es, wir würden für den islamischen Religionsunterricht und die Ausbildung der Geistlichen genügend eigene Angebote haben. Dazu muss auch in den Gemeinden Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Sie sind einer der prominentesten Ostdeutschen, Deutschland feiert das Jahr 30 nach dem Mauerfall und im Herbst sind Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern. Gibt es Unterschiede in der Toleranz im Westen und Osten?
Ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung denkt und wählt tatsächlich anders. Nicht, weil diese Menschen einen schlechteren Charakter hätten, sondern weil sie eine andere Geschichte haben. Westdeutschland konnte über zwei Generationen lernen, was Demokratie ist. Schule, Uni, Medien und Gewerkschaften haben geholfen, einen Citoyen zu formen. Den eigenverantwortlichen Bürger. In Ostdeutschland mussten die Menschen von 1933 bis 1989 in Diktaturen leben, da entstehen typische Verhaltensweisen. Im Osten gibt es eine Geschichte der Anpassung. Doch die Differenz zwischen Ost- und Westdeutschen wird sich erledigen. Wenn wir ein oder zwei Generationen weiter sind, wird es diese Unterschiede kaum mehr geben.
Meinen Sie?
Ja, davon gehe ich aus. Menschen brauchen ihre Zeit, den Gestus eines selbstverantwortlichen Bürgers zu trainieren.
Was fühlen Sie, wenn Sie an die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen denken?
Mein Optimismus hält sich in Grenzen. Andererseits sehe ich in den meisten Protestwählern Menschen, die die etablierten Politiker vor allem düpieren wollen, aber kein festgefügtes autoritäres Profil besitzen. Einst profitierte davon am meisten die PDS/ DIE LINKE, jetzt die AfD. Hätten wir im Westen dieselben Ergebnisse wie im Osten, dann wäre ich besorgter.
Die AfD-Wähler sind nicht nur Protestwähler und die AfD wird auch von Jungen gewählt, die gar nicht in der DDR aufgewachsen sind.
Es geht um Fremdheit und Vertrautheit. Fremdheit gegenüber der Moderne ist generell ein Problem. Im Buch verweise ich auf Studien, wonach für 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung Sicherheit, Vertrautheit, Konformität einen besonders hohen Stellenwert besitzen. In Ostdeutschland und anderen postkommunistischen Staaten kommt erschwerend hinzu, dass flexible, offene, risikobereite Menschen in großer Zahl aus diesen Regionen abgewandert sind. So ist eine ziemlich stabile, sehr spezielle politisch-psychologische Struktur entstanden, die sich offensichtlich nur langsam ändern kann.
Einfach so? Das kommt uns sehr arglos vor.
Es ändert sich durch die Lebensprozesse in einer offenen Gesellschaft. Die Kindergärten und Schulen im Osten sind heute total anders. Es gibt keinen Zwang mehr, sich anzupassen. Damit wird der Typus des Untertanen seltener. Es gibt Lernmöglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben als befreiend zu erleben. Ich finde es zudem wirklich beeindruckend, wie viele Ostdeutsche sich befreit haben von der Ohnmacht und aktiv im politischen und wirtschaftlichen Leben stehen. Und ob wir es wollen oder nicht: Der Wandel geschieht. Wir tun gut daran – in Ost und West – sich ihm zu stellen und zu gestalten.
- Ostdeutschland wird leerer: Einwohnerzahl auf Tiefstand
- Merkels Vermächtnis: Sie wird nicht ohne Kampf verschwinden
- Essay: Es gibt keinen Rechtsruck – warum erstarkt die extreme Rechte trotzdem?
- Quiz: Wie gut kennen Sie Ostdeutschland?
Im Großen und Ganzen ist die Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte?
Aber selbstverständlich! Die Mehrheit der Ostdeutschen steht zur offenen Gesellschaft. Ich plädiere dafür, den Weg in eine bessere Zukunft zu gehen, aber durchzuatmen, das Schrittmaß ab und an auch zu verlangsamen und so mehr Menschen mitzunehmen.
- Persönliches Interview in Berlin
- Der Spiegel: "Wir müssen lernen, mutiger intolerant zu sein" (kostenpflichtig)










 News folgen
News folgen