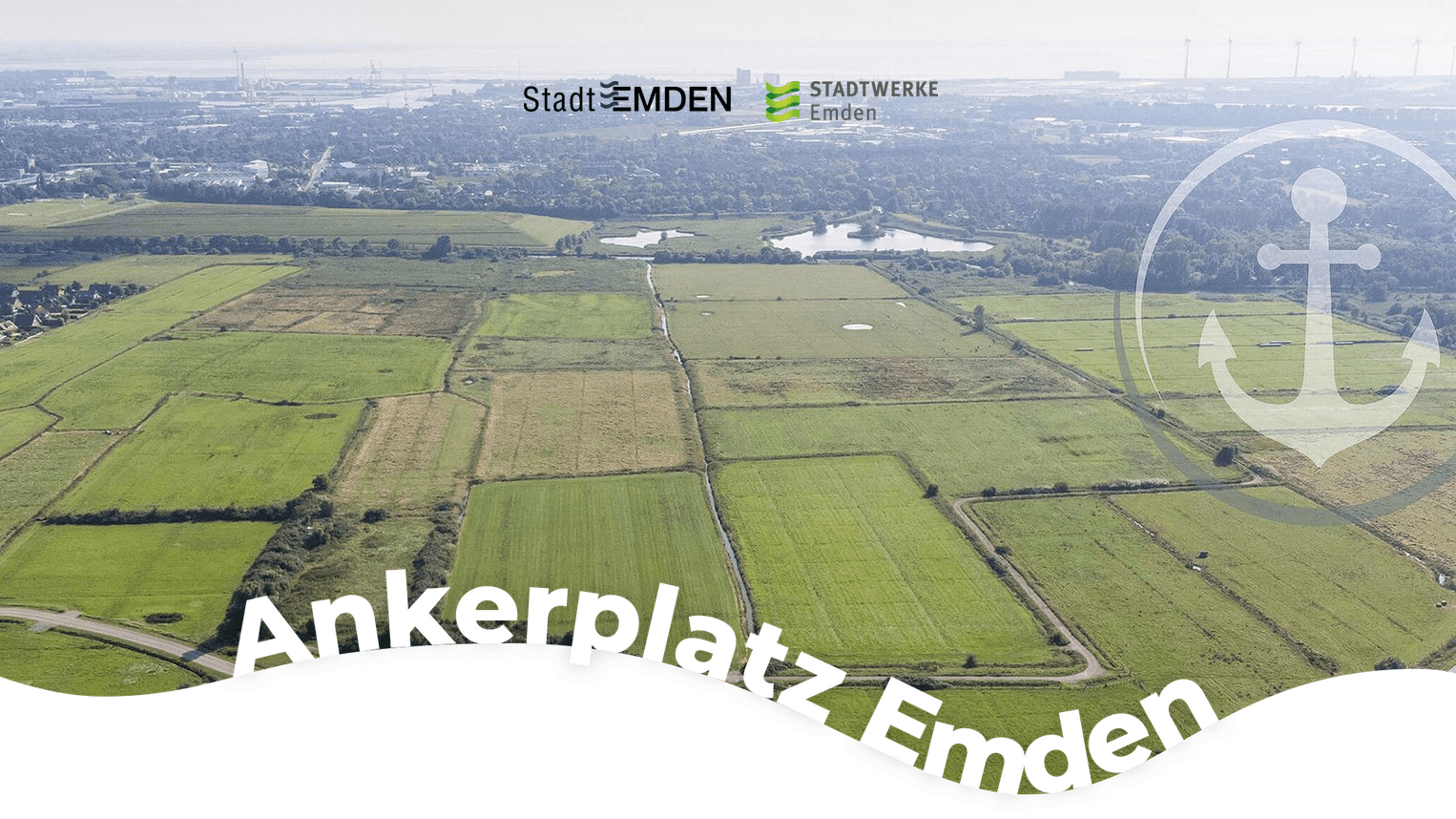Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Nabu-Präsident warnt vor Flächenfraß "Wir machen Deutschland kaputt"


Die Bevölkerung schrumpft, doch die Betonwüste wuchert weiter: Aus Wiesen und Wäldern werden Neubaugebiete und Logistikzentren. Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Nabu, warnt vor Problemen.
Wenn die Bagger anrollen, ist es längst zu spät. Noch immer werden riesige Naturflächen in Deutschland trockengelegt, zugeschüttet und zu Bauland gemacht.
Tag für Tag geht dadurch eine Fläche verloren, die so groß ist, dass die Hektarzahl nicht ausreicht, um das Ausmaß des Schadens zu begreifen: 70 Fußballfelder werden täglich zur Betonwüste. Das betrifft nicht nur Ackerland, sondern vielfach auch besonders schützenswerte Gebiete, in denen gefährdete Tier- und Pflanzenarten Zuflucht finden.
Noch knapp 30 Jahre lang soll Natur zu Beton werden
Schon im vergangenen Jahr wollte die Bundesregierung den "Flächenfraß" deshalb auf 30 Hektar pro Tag begrenzen. Das entspräche immerhin noch rund 40 Fußballfeldern.
Inzwischen wurde das Ziel verschoben; die Reduzierung ist nun für 2030 angepeilt. Ganz will man den Flächenverbrauch in der Bundesrepublik aber weiterhin erst ab dem Jahr 2050 stoppen.
Als Präsident der größten deutschen Umweltschutzorganisation Nabu bereitet das Jörg-Andreas Krüger große Sorge. Im Interview mit t-online erzählt er, wieso der Negativpreis des Nabu dieses Jahr an ein Projekt in Norddeutschland geht und weshalb der Bauboom auch eine Gefahr für den Menschen ist.
t-online: Herr Krüger, Sie sind kurz nach Weihnachten mit einem Dinosaurier im Koffer nach Emden gereist. Gehört das zur Stellenbeschreibung des Nabu-Präsidenten?
Jörg-Andreas Krüger: Das war immerhin der Dino des Jahres! Wir verleihen diesen Negativpreis seit 1993 an Projekte, die schwere Folgen für die Umwelt haben. Für 2021 hat Emden die fast drei Kilo schwere Auszeichnung besonders verdient: ein kleiner Umweltsaurier für eine große Umweltsauerei.
Was ist denn in Ostfriesland los?
Die Stadt Emden hat ein großes Neubaugebiet ausgewiesen, obwohl die Einwohnerzahl sich seit Jahrzehnten kaum ändert. Sie geht sogar leicht zurück.
Der Bürgermeister versucht also, mit Speck Mäuse zu fangen: Mühevoll will er so neue Familien anlocken, die sonst nicht kommen würden. Und das alles zulasten von Natur und Landschaft.
Ohne in die Natur einzugreifen, lässt sich aber nichts bauen.
Sicher, allerdings ist das Baugebiet in Emden-Conrebbersweg dafür besonders schlecht geeignet. Einerseits liegt es einen Meter unter dem Meeresspiegel, was einen Riesenaufwand für den Hochwasserschutz bedeutet. Andererseits sind dort viele stark gefährdete Vogel- und Pflanzenarten zu Hause. Statt aus der Fläche ein Naturschutzgebiet zu machen, werden jetzt auf zwei Dritteln des Bodens Häuser gestellt, die niemand wirklich braucht.
Wie viel schlauer geht es im Rest der Bundesrepublik zu?
Gerade das ist das Problem: Emden ist kein Einzelfall. Fast jede Kommune plant weitere Flächenversiegelung, überall in Deutschland wuchern die Siedlungen. Dazu kommen die nötigen Verkehrswege und die Infrastruktur für Energie, Wasser und Abwasser. Täglich verschwinden in Deutschland 50 Hektar Natur, indem Flächen zubetoniert, asphaltiert oder gepflastert werden.
Wie lange kann das so weitergehen?
Eigentlich schon gestern nicht mehr. Wir müssen einfach anerkennen: Die Fläche ist begrenzt. Deutschland bekommt Platzprobleme, irgendwann ist das Land dicht.
Das kann man sich kaum vorstellen – vor allem mit Blick auf dünn besiedelte Landstriche.
Sicher, in Mecklenburg-Vorpommern wird man wohl auch in drei Jahrzehnten noch freie Fläche finden. Aber beispielsweise in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und NRW wird es ganz schön eng. Wir müssen den Flächenfraß stoppen.

Embed
Was passiert, wenn das nicht gelingt, wenn es weiter neue Lagerhallen für den Onlinehandel braucht und alle weiter vom Eigenheim im Grünen träumen?
Dann verlieren wir dadurch in den kommenden 30 Jahren eine Fläche von der Größe des Saarlandes. Pflanzen und Tiere müssen fliehen oder werden vernichtet. Der Boden kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil das Wasser auf den versiegelten Flächen nicht richtig versickert. Der Grundwasserpegel sinkt, was Dürreschäden verstärkt und Trinkwassermangel verschärft. Bei Starkregen steigt die Überschwemmungsgefahr. In den Städten werden die Sommer heißer, weil Kaltluftschneisen zugebaut werden. Hier steht viel auf dem Spiel.
Ab 2050 will die Bundesregierung dafür sorgen, dass keine zusätzlichen Flächen mehr verbraucht werden. Wie viel Hoffnung macht Ihnen das?
Wir machen Deutschland dadurch kaputt, dass wir alles zubauen. Das ist nicht erst in 30 Jahren ein Problem. Mit jeder neuen Baufläche frisst sich der Mensch in die Natur hinein, während in vielen Innenstädten Gebäude leer stehen.
Jedes Jahr entstehen mehr als 100.000 neue Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland, während die Bevölkerung mittelfristig schrumpft. Sind also die Häuslebauer schuld?
Na ja, das ist eine Wohnform, die bei uns unglaublich tief verwurzelt ist. Vor allem in kleinen und mittleren Städten und in ländlichen Gebieten. Deswegen eskaliert die Debatte rund ums "Häuslebauen" ähnlich schnell wie der Streit um Tempolimit oder SUV-Verbot.
Wenn Neubaugebiete in die Vergangenheit gehören sollen, was ist die Alternative?
Wir müssen unsere Innenstädte nachverdichten. Und zwar auf eine attraktive Art, die den Leuten Lust macht, dort zu wohnen.
Das heißt?
Dachstühle ausbauen, zusätzliche Geschosse in Leichtbauweise aufstocken, ungenutzte Baulücken füllen. Kurz: in die Höhe statt in die Breite gehen. Und dabei nicht nur in Wohneinheiten, sondern auch in Lebensqualität denken. Nachhaltige Quartiersentwicklung muss öffentliche Plätze wieder zu schönen Treffpunkten macht, grüne Oasen in der Stadt erhalten, verschiedene Generationen zusammenbringen, günstige und grüne Mobilität für alle ermöglichen. Dafür brauchen die Städte aber auch Unterstützung von Bund und Ländern.
Das klingt vor allem nach einer Aufgabe für Bauämter und Bürgermeister. Wie können einzelne Personen und Familien etwas gegen den Flächenfraß tun?
Wichtig ist vor allem die Entscheidung, wie man selbst wohnen möchte. Wie viele Quadratmeter brauche ich wirklich? Muss ich mir ein neues Haus auf die grüne Wiese stellen oder saniere ich einen Altbau? Habe ich Lust auf Gartenarbeit rund ums klassische Einfamilienhaus oder reicht auch ein schöner Balkon? An diesen persönlichen Lebensentscheidungen hängt viel dran.
Aber eben nicht alles.
Ja, da ist es so wie beim Klimaschutz. Nur die Hälfte meines eigenen CO2-Fußabdrucks habe ich direkt darüber in der Hand, wie ich wohne, heize, unterwegs bin und mich ernähre. Der Rest sind strukturelle Entscheidungen, die andere für mich treffen. Ähnlich ist es beim Flächenverbrauch. Und darauf macht der Dino des Jahres aufmerksam. Ab jetzt auch im Emdener Rathaus.
Herr Krüger, vielen Dank für das Gespräch.
- Interview mit Jörg-Andreas Krüger, Präsident der Naturschutzorganisation Nabu
- Statistisches Bundesamt (2021): Vorberechnung des Bevölkerungsstands in Deutschland (1950-2060*)
- Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. N015 (2021): Von Januar bis November 2020 genehmigte Wohnungen
- Statistisches Bundesamt (2021): Anzahl der Einfamilienhäuser in Deutschland 2020, Bautätigkeit und Wohnungen – Bestand an Wohnungen 2020, S.10
Quellen anzeigen