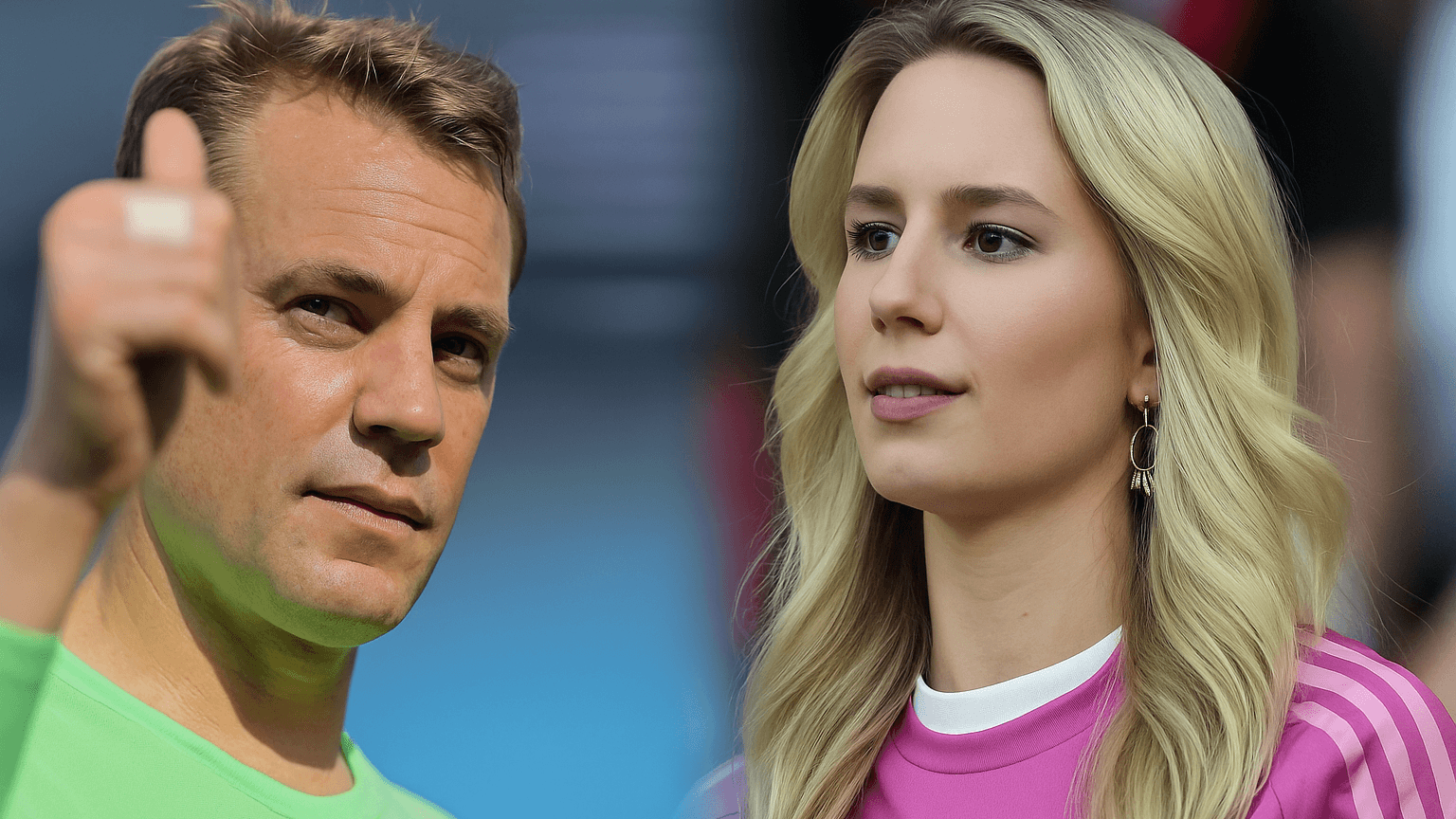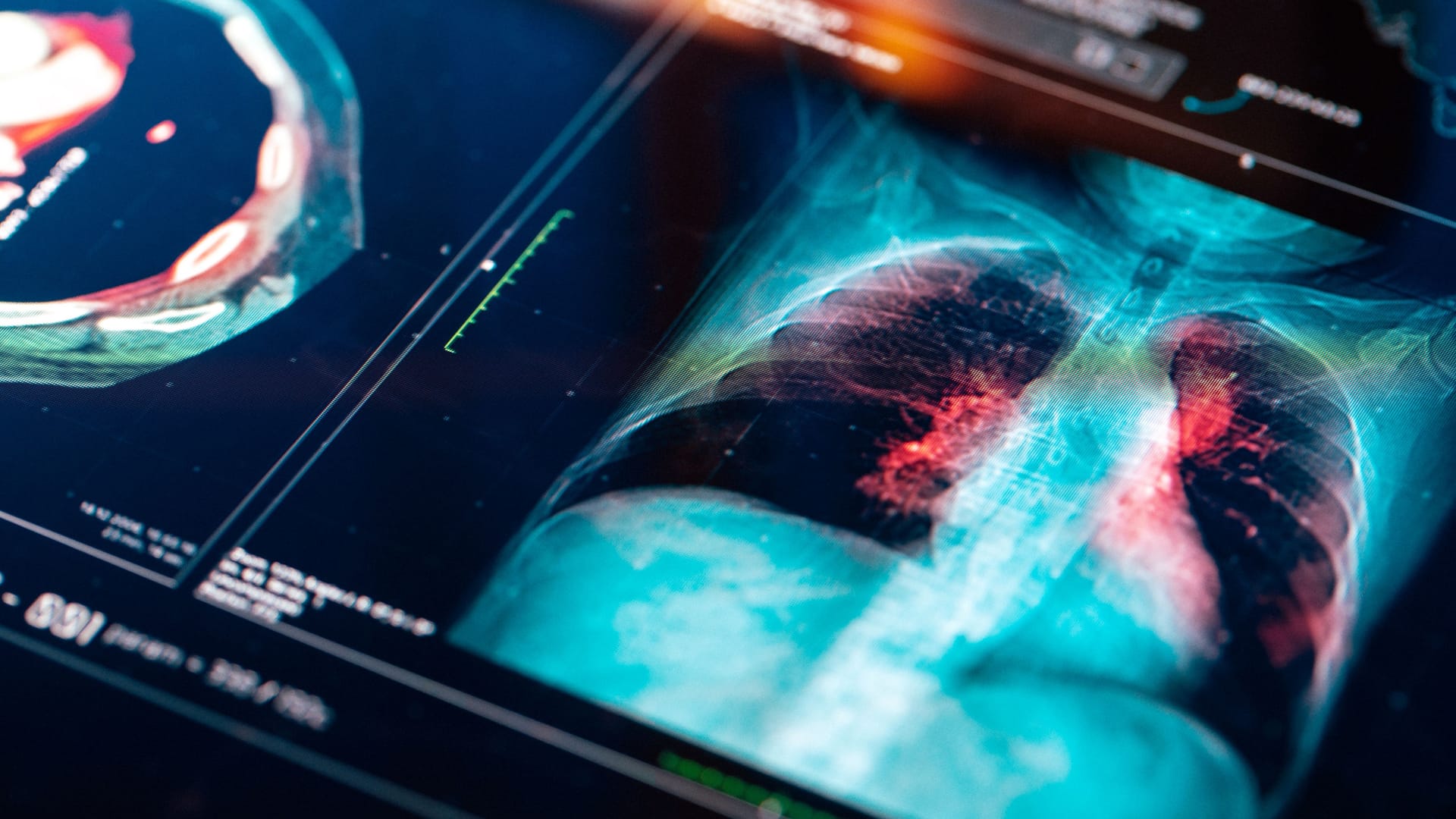Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Fasten für Körper und Geist Heilfasten nach Buchinger: Wie es funktioniert und was zu beachten ist


Das Heilfasten gilt als wirksamste Form des Fastens. Doch was ist der Ursprung des Heilfastens, wie funktioniert es und für wen eignet sich die Methode?
Ob klassisches Brühefasten, Saftkuren oder der Verzicht auf einzelne Nahrungsmittel wie Schokolade oder Alkohol – Fasten ist inzwischen ein Trend mit vielen Formen. Doch woher stammt das Prinzip des Verzichts nach bestimmten Regeln? Und was macht das Heilfasten nach Buchinger so besonders?
Otto Buchinger: Die Grundlagen des Heilfastens
Schon in der Antike und im Mittelalter wurde aus medizinischen und spirituellen Gründen gefastet. Schriftlich mit eigenen Erfahrungen und Beobachtungen festgehalten und in der Welt bekannt gemacht haben es Otto Buchinger, sein Sohn und sein Enkel ab dem Jahr 1935.
Als der Mediziner Otto Buchinger durch eine nicht ausgeheilte Mandelentzündung an Rheuma erkrankte, unterzog er sich einer knapp dreiwöchigen Fastenkur und besiegte die Erkrankung. Dies legte den Grundstein für seine Forschung im Gebiet der Naturheilkunde mit dem Schwerpunkt auf das Fasten.
1920 gründete er eine Heilfastenklinik, die seine Nachfahren in der vierten Generation noch heute in Bad Pyrmont aktiv weiterführen. Das 1935 veröffentlichte Hauptwerk "Das Heilfasten und seine Hilfsmethoden" wird noch immer regelmäßig neu aufgelegt und aktualisiert. 1966 starb Otto Buchinger im Alter von 89 Jahren.
Definition des Fastens nach der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung e. V.:
Das Fasten ist der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für begrenzte Zeit. Bei richtig durchgeführtem Fasten besteht gute Leistungsfähigkeit ohne großes Hungergefühl.
Entschlackung durch Fasten – missverständlicher Begriff
Eine Heilfastenkur nach Buchinger dauert üblicherweise zwischen sieben und zehn Tagen. In dieser Zeit nehmen Sie nur eine sehr geringe Energiemenge von maximal 500 Kilokalorien pro Tag in Form von flüssiger Nahrung auf. Das soll die Ausscheidung von Schadstoffen aus dem Körper vereinfachen.
Doch Buchinger stieß seitens der Schulmedizin auf Kritik, als er die Begriffe "Entschlackung" oder "Entgiftung" einführte. Denn "Schlacken", also schädliche Ablagerungen im Körper, gibt es nicht. Zudem entgiftet sich der gesunde Körper selbst – auch ohne zu fasten. Dafür sind Organe wie Leber, Nieren und der Darm verantwortlich. Laut Buchinger sollten die Begriffe allerdings nur eine Metapher darstellen für die vielen Vorgänge im Körper, die während des Fastens angeregt werden. Denn obwohl es Schlacken nicht gibt, ist Fasten keineswegs wirkungslos.
Info: So funktioniert die körpereigene Entgiftung
Der menschliche Organismus hat ein höchst effektives System entwickelt, schädliche Substanzen aus dem Körper zu entfernen. Besonders wichtig für die körpereigene Entgiftung sind dabei die Leber, die Nieren, der Darm, die Haut und die Lunge. Sie enthalten spezielle Enzyme, mit denen sie Schadstoffe in eine weniger giftige Form umwandeln können. Auf diese Weise ist es einfacher für den Körper, sie anschließend über die Niere (Urin), den Darm (Stuhl), über die Haut (Schweiß) oder die Lunge (Atem) auszuscheiden.
Heilfastenkur nach Buchinger wirkt vielfältig
Allgemein führt Fasten dazu, dass sich der Stoffwechsel umstellt. Da keine beziehungsweise weniger Nährstoffe aufgenommen werden, muss der Körper auf seine Energiereserven zurückgreifen. Innerhalb der ersten 12 Stunden des Fastens werden die Kohlenhydratspeicher in der Leber aufgebraucht. Anschließend greift der Körper auf seine Fettreserven zurück. Aus dieser Umstellung des Stoffwechsels ergeben sich unter anderem folgende Effekte:
- Abbau von Fettreserven
- Senkung der Cholesterin- und Blutfettwerte
- Senkung des Blutdrucks und Blutzuckers
- Aktivierung von Recycling- und Reparaturmechanismen (durch die sogenannte Autophagie kann der Körper fehlerhafte Strukturen in Zellen selbständig abbauen und daraus neue Energie gewinnen)
- Reduktion von Entzündungsstoffen im Blut
- Ausschüttung von Glückshormonen wie Endorphinen und Serotonin
- Gewichtsreduktion
Info: Fasten wirkt nicht immer gleich
Neben dem Heilfasten hat vor allem das Intervallfasten einen wissenschaftlich bestätigten gesundheitlichen Nutzen. Andere Fastenformen wie das Basen-, Schein- oder Saftfasten sind in ihrer Wirksamkeit nicht wissenschaftlich bewiesen.
Lesen Sie auch:
- Den Körper entgiften: Was bringen Detox-Kuren?
- Gegen Fettleber: Leberwickel bringen nichts – was wirklich hilft
Für wen ist Heilfasten nach Buchinger geeignet?
Aufgrund dieser vielfältigen Prozesse kann eine Heilfasten-Therapie sowohl für gesunde Menschen zur Prävention als auch zur Therapie bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden. Wissenschaftlich bestätigt ist eine unterstützende Wirkung etwa bei:
- chronischen Entzündungen wie rheumatischer Arthritis
- chronischen Schmerzzuständen
- kardiovaskulären Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz
- dem Metabolischen Syndrom
- psychischen Erkrankungen wie Depressionen
- Erkrankungen des Verdauungstrakts wie chronischer Colitis
- Hauterkrankungen wie Neurodermitis
Info: Heilfasten und Abnehmen
Fasten ist nicht dazu geeignet, um langfristig abzunehmen. Allerdings können Sie das Fasten als Einstieg in eine nachhaltige Ernährungsumstellung nutzen. Denn nach dem Verzicht auf Nahrung nehmen Sie süße und salzige Geschmäcker sowie die inneren Signale für Hunger, Sättigung und Appetit bewusster wahr. Zudem kann die Motivation für einen gesundheitsfördernden Lebensstil durch den ersten Gewichtsverlust und die stimmungsaufhellende Wirkung des Fastens steigen.
Für wen eignet sich das Heilfasten nicht?
Da eine Fastentherapie in eine Vielzahl von Stoffwechselvorgängen eingreift, sollte besonders bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen geklärt werden, ob das Fasten in diesem Fall gesundheitsfördernd wäre. Gänzlich ungeeignet ist Fasten zudem bei:
- Magersucht
- Demenz
- fortgeschrittene Leber- oder Niereninsuffizienz
- Schwangerschaft und Stillzeit
Bei Suchterkrankungen, Typ-1-Diabetes oder fortgeschrittener koronarer Herzerkrankung sollte eine Fastentherapie zudem nur mit Betreuung durch erfahrene Fastenärzte erfolgen. Bei Übergewicht kann zusätzlich zu den zuvor genannten Tests auch eine Stoffwechselanalyse sinnvoll sein. Wann und warum Ihnen Fasten und Diäten wie Low Carb schaden können, erklärt Daniela Kielkowski im Interview. Sie ist Ärztin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin in Berlin.
Info: Fasten und Muskulatur
Während des Fastens verwertet der Körper auch Proteine aus der Muskulatur. Dadurch wird während des Fastens immer auch ein Teil Ihrer Muskelmasse abgebaut. Wer keine Muskelmasse verlieren möchte, für den ist Heilfasten nicht geeignet.
Eine Heilfastenkur sollte gut geplant sein
Mit dem Heilfasten sollten Sie Ihrem Körper und Ihrem Geist etwas Gutes tun wollen. Dazu gehört auch, über seinen Lebensstil wie etwa ungesunde Gewohnheiten, Ernährung und Bewegung nachzudenken. Das Fasten soll also einen Anreiz schaffen, auch danach bewusster und gesünder zu leben.
Außerdem sollten Sie eine Heilfastenkur nicht leichtfertig starten, denn sie tut nicht jedem Menschen gleich gut. Jeder, der fasten möchte, sollte also nicht allzu lange vor Beginn der Kur einen Bluttest und ein EKG durchgeführt haben, empfiehlt Buchinger. Aufgrund dieser Gesundheitsdaten kann Ihr Arzt anschließend herausfinden, ob sich eine Fastenkur für Sie eignet oder nicht.
Fastenplan: 7-Tage-Programm für zu Hause – so funktioniert es
Das Heilfasten nach Buchinger folgt festgelegten Regeln. Eine Heilfastenkur dauert üblicherweise sieben bis zehn Tage. Zudem sollten Sie einen Vorbereitungstag sowie nach dem Fasten drei Tage zur Normalisierung des Essverhaltens einplanen. Wichtig ist auch, dass Fastende die Anleitungen zum Kostaufbau befolgen, um negative Effekte zu minimieren.
Entlastungstage – So bereiten Sie sich auf das Heilfasten vor
Haben Sie die Zustimmung Ihres Arztes bekommen, sollten Sie Ihren Körper auf die kommenden Tage vorbereiten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Kaufen Sie sich Gemüsebrühe sowie frisches Gemüse und Obst für frisch gepresste Säfte. Notfalls können sie auch Direktsäfte aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten verwenden. Auch verschiedene Kräutertees sollten für die kommenden Tage zu Ihrem Speiseplan gehören. Tee aus Ingwer, Honig (in Maßen) und Zitrone dürfen Sie ebenfalls trinken. Die Gemüsebrühe dürfen Sie auch selbst einkochen. Nur dürfen keine größeren Stückchen enthalten sein.
- Besorgen Sie sich Glaubersalz. Denn am Anfang der Kur sollten Sie abführen – also Ihren Darm komplett entleeren.
- Essen Sie ein bis drei Tage vor der Fastenkur keine schweren Gerichte wie beispielsweise Hackbraten, Pizza oder Burger – und verzichten Sie auf Fertigprodukte. Essen Sie viel Gemüse und trinken Sie klare Gemüsebrühe, um den Körper einzustimmen. Das sind die sogenannten Entlastungstage.
- Verzichten Sie zudem auf Genussmittel wie Zigaretten und Kaffee – oder versuchen Sie, beides stark zu reduzieren. Auch Alkohol sollten sie nicht trinken.
- Stimmen Sie sich mental ein und bauen Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag ein, etwa durch Spaziergänge. Auch Meditation kann Ihnen dabei helfen, zur Ruhe zu finden.
- Einen Tag vor Beginn – dem Tag der Darmentleerung – sollten Sie am besten nicht mehr als 1.000 Kalorien essen.
Die Darmentleerung mit Glaubersalz
Um in die Kur zu starten, entleeren Sie Ihren Darm. Dazu trinken Sie innerhalb von 20 Minuten einen halben Liter Wasser mit 30 bis 40 Gramm Glaubersalz. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig – nicht umsonst heißt es auch Bittersalz. Nach 30 bis 60 Minuten trinken Sie noch einmal einen halben Liter Wasser nach, um den Vorgang anzukurbeln.
Tipp: Um die bittere Note zu dämpfen, können Sie den Saft einer Zitrone oder einen Schuss Himbeersirup dazugeben.
Sie brauchen mehr Informationen zur Darmreinigung mit Glaubersalz? Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung.
Tag 1 bis 7: Das dürfen Sie während der Fastenkur essen
In der Zeit des Fastens dürfen Sie über den Tag verteilt
- 250 Milliliter Gemüsebrühe ohne Einlage,
- 250 Milliliter Frucht- oder Gemüsesaft und
- zwei bis maximal drei Esslöffel Honig zu sich nehmen.
Insgesamt sollte Ihre Kalorienzufuhr bei etwa 500 Kilokalorien pro Tag liegen. Besonders wichtig sind zudem zwei bis drei Liter Flüssigkeit in Form von Kräutertee, Ingwertee oder stillem Wasser zu trinken, um die Stoffwechselprozesse zu unterstützen.
Das sollten Sie nicht tun:
- Zwischendurch essen
- Zu wenig trinken: Genügend Flüssigkeit fördert die Nierentätigkeit.
- Zu wenig Bewegung: Bewegung regt den Blutkreislauf und die Zirkulation von beispielsweise Sauerstoff an. Sie verhindert außerdem einen zu starken Muskelabbau.
- Zu viel Bewegung: Verzichten Sie auf sportliche Höchstleistungen. Führen Sie stattdessen moderates Ausdauertraining durch oder gehen Sie spazieren. Am besten besprechen Sie auch das mit Ihrem Arzt.
- Nach dem Fasten den Magen und Darm mit zu üppigen oder schwer verdaulichen Mahlzeiten überfordern.
Fastenbrechen – Aufbautage nach dem Fasten einplanen
Um den Verdauungstrakt nach der Fastenzeit nicht zu überfordern, sollten Sie an Ihrem letzten Fastentag erst einmal nur wenig essen. Ein geriebener Apfel oder eine kleine Portion Kartoffelsuppe zählen zu den typischen Speisen des Fastenbrechens.
Kauen Sie zudem langsam und genießen Sie das Gefühl bewusst. Es ist deshalb so wichtig, langsam anzufangen, da sonst Magenschmerzen, Übelkeit oder Verstopfungen auftreten können.
Faustregel: Die Aufbautage sollten in der Regel ein Drittel der Fastenzeit ausmachen. Wenn Sie eine Woche lang gefastet haben, sollten Sie zwei bis drei Tage ihren Körper langsam an feste Nahrung gewöhnen.
Die nächsten Tage sollten Sie laut Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung e. V. auf naturbelassene, vegetarische und faserstoffreiche Produkte setzen.
Dazu gehören beispielsweise:
- Vollkornprodukte
- Gemüse
- Leinsamen
- kaltgepresse Pflanzenöle
Steigern Sie von Tag zu Tag Ihre Kalorienzufuhr bis zu Ihrem individuellen Bedarf und vergessen Sie nicht, während und zwischen den Mahlzeiten weiterhin ausreichend zu trinken. Das ist wichtig, da der Magen nun wieder vermehrt Magensäfte für die Verdauung produzieren muss – so unterstützen Sie ihn dabei.
- Kalorienbedarf berechnen: Wie viele Kalorien braucht Ihr Körper?
Die spirituelle Seite des Fastens nutzen
Nehmen Sie sich bewusst Zeit nur für sich. Otto Buchinger empfiehlt, Zeit mit Kunst, Musik, Lesen, Natur oder Meditation zu verbringen. Auch lange Spaziergänge oder leichtes Ausdauertraining tun nicht nur Ihrem Körper gut, sondern wirken befreiend für den Kopf und die Gedanken.
Das Buchinger Heilfasten sieht Massagen, Kneippanwendungen, Gymnastik und Saunagänge vor, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen. Je nachdem, wie viel Zeit Sie haben, können Sie versuchen, einiges davon – zum Beispiel am Wochenende – in Ihre Fastenzeit einzubauen.
Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.
Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.
Neue Gewohnheiten einbinden
Wenn Sie vorher schon eine gesunde und ausgewogene Ernährung hatten, dann können Sie diese weiterführen. Haben Sie vorher eher ungesund, zu viel oder unregelmäßig gegessen, nutzen Sie die Zeit nach dem Fasten, sich an neue Essgewohnheiten zu gewöhnen und einen Grundstein zur gesunden und bewussten Ernährung zu legen.
Heilfasten: Diese Nebenwirkungen sind möglich
Das Fasten kann positive Effekte mit sich bringen, aber ebenso – besonders in der Anfangsphase – negative Begleiterscheinungen aufweisen. Hier finden Sie eine Übersicht der möglichen nachgewiesenen Nebenwirkungen während der Fastenkur.
- Kreislaufprobleme: Sie zeigt sich unter anderem in Schwindelattacken.
- Unterzuckerung: Sie zeigt sich unter anderem durch Kopfschmerzen oder Zittern.
- Migräneanfälle: Sie können durch Unterzuckerung vorkommen.
- Akuter Lumbago: Ein Hexenschuss, also Schmerzen im unteren Rücken, sind eine mögliche Begleiterscheinung.
- Muskelkrämpfe: Sie können durch einen Mangel an Magnesium entstehen.
- Schlafveränderungen: Schlafstörungen durch Unterzuckerung sind möglich.
- Mundgeruch: Er entsteht, da bei der vermehrten Fettverbrennung im Körper freie Fettsäuren gebildet werden, sogenannte Ketonkörper. Sie führen zum typischen "Azetongeruch" der Atemluft.
- Gichtanfall: Durch die verstärkte Fettverbrennung kann es zum Anstieg von Harnsäure kommen. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Harnsäurekonzentration und Ihre Nierenfunktion vor dem Fasten überprüfen lassen. Außerdem ist es wichtig, während der Fastenkur ausreichend viel zu trinken, um die Nieren nicht zusätzlich zu belasten.
- Jo-Jo-Effekt: Beim Fasten sinkt Ihr Grundumsatz. Je niedriger der Grundumsatz ist, desto weniger Kalorien benötigt der Körper in Ruhe. Nehmen Sie nach dem Fasten wieder mehr Kalorien zu sich, speichert Ihr Körper diese überschüssige Energie in Fettdepots, um sich vor einer erneuten Hungerperiode zu schützen.
Sollten Sie starke Nebenwirkungen wie Migräneattacken oder Herz- und Kreislaufprobleme bekommen, wenden Sie sich besser an Ihren Arzt und brechen im Zweifelsfall die Fastenkur ab. Jeder Körper ist anders und reagiert auch nicht immer gleich gut oder schlecht auf bestimmte Veränderungen.
- bzfe.de: "Fasten – Moderne Aspekte eines klassischen Naturheilverfahrens". (Abrufdatum Februar 2024)
- gesundheit.gv.at: "Fasten & Detox". (Stand: September 2020)
- pschyrembel.de: "Autophagie". (Stand: März 2023)
- dge.de: "Heilfasten, Basenfasten, Intervallfasten". (Stand: 2018)
- ugb.de: "Autophagie: Können sich durch Fasten Körperzellen selbst reinigen?". (Stand: 2017)
- aerztegesellschaft-heilfasten.de: "Leitlinien zur Fastentherapie". (Stand: 2002)
- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.
Quellen anzeigen