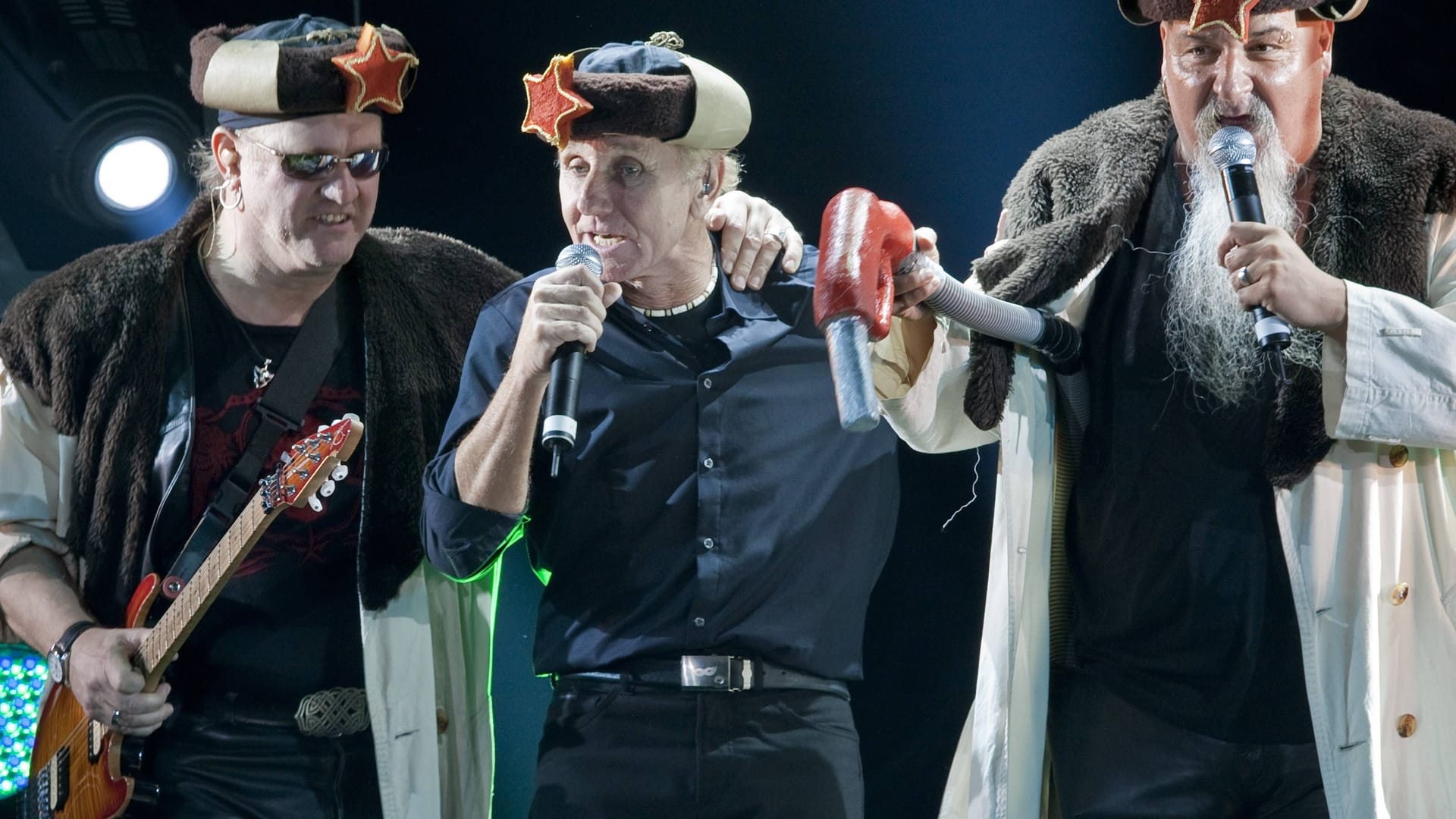Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Medienkonsum So verblödet Deutschland


Unser Kolumnist macht so Sachen. Er liest zum Beispiel die Zeitung. Das animiert ihn manchmal zum Nachdenken. Am Wochenende darüber, was Martin Walser, das Wetter und Jörg Kachelmann miteinander zu tun haben.
Kennen Sie das? An vielen Tagen liest man eine Zeitung, besser gesagt, man blättert oder wischt sich durch, ohne irgendwo hängenzubleiben. Legt sie enttäuscht zusammen oder das Tablet beiseite. Hätte man sich sparen können. Der ikonische Satz von Kurt Tucholsky greift an diesen Tagen nicht. Er wunderte sich bekanntlich einmal, dass immer genauso so viel passiere, wie in die Zeitung passe. Manchmal passiert eben auch weniger. Oder die Redaktion hatte einen uninspirierten Tag. Oder beides zusammen.
Und dann gibt es Tage, an denen man sich an der Ausgabe festsaugt, wie die Schmerle oder der Zwergwels am Glas des Aquariums. So ein Tag war dieser Samstag. Die Ausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": Ein Feuerwerk an Esprit und Erkenntnis! Erst mal das Interview mit dem amerikanischen Top-Journalisten Michael Wolf, von dem Hunderte Seiten transkribierte Interviews mit Jeffrey Epstein stammen. Donald Trump wird man nie ganz verstehen – aber nach diesem Interview ein wenig mehr. Und auch, warum er den Daumen so auf diese Epstein-Akten hält. Alles sehr aufschlussreich – weshalb Auszüge des FAZ-Interviews mit Wolf zu Recht auch den Weg auf unsere Seite gefunden haben.

Zur Person
Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.
So auch das Gespräch mit der neuen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Man muss ihre Positionen nicht teilen (viele teile ich indes), aber das war mal kein Politgeschwurbel, sondern Reden ohne Schalldämpfer. Auch dieses Gespräch und seine Kernaussagen schafften es in die Agenturen und auf unsere Seite. (Sie sehen: Hier sind Sie auch dann anständig informiert, wenn ausnahmsweise nicht wir, sondern unsere lieben Wettbewerber etwas Gutes aufgetan haben.)
Aber die wirklichen Fundstücke warteten im Feuilleton (dort stand auch das Wolf-Interview) und in der Beilage "Bilder und Zeiten". Weil es sich bei der "FAZ" um eine herrlich anarchistische Zeitung handelt, in der jedes Ressort einfach macht, was es will, erschienen hier und dort zwei Stücke, die ein überwölbend Draufschauender vermutlich wegen Doubletten-Gefahr oder jedenfalls großer thematischer Nähe entzerrt hätte.
Zum einen wartete der emeritierte Literaturwissenschaftler Helmuth Kiesel (bei dem ich in Bamberg die Freude hatte zu studieren) mit einer wirklichen Sensation auf, die er seinen im Lauf der Lektüre immer mehr staunenden Lesern ganz ruhig und ohne Bohei präsentierte. Kiesel durfte in die bislang nicht bekannten Manuskriptseiten von Martin Walser Einblick nehmen. Verhärmt hatte er sie im Nachgang zum erbitterten Streit über seine Paulskirchenrede 1998 geschrieben, neben dem eher missglückten Roman "Tod eines Kritikers", der in diesem Zusammenhang mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki abrechnete. In diesem Manuskript verkörpert ein Professor Wesendonk die Gegenfigur zu einem Autor namens Hans Lach (!). Wesendonk steht stellvertretend für die ganze Meute, die Walser alias Lach seinerzeit als vermeintliche Nazi-Relativierer jagte. Über 150 Seiten, notiert von Walser auf den Rückseiten der Fahnen des "Kritikers". Verwahrt nach Walsers Tod bei einem Freund. Kiesel durfte nun lesen und davon berichten, jedoch nicht daraus zitieren. Nur so viel sei verraten: Lach hatte nichts zu lachen, er verzweifelt und wird seiner Ehre beraubt von der erbarmungslosen und "schamlosen Suada des Professors Wesendonk".
Der Fall Walser, der von einer "Ritualisierung der Schuld" und einer "Instrumentalisierung der Erinnerung" an Auschwitz gesprochen hatte, erinnert in seinem Verlauf und Ausgang an die aktuell aus dem Ruder gelaufenen Debatte um die mögliche Verfassungsrichterin Brosius-Gersdorf.
Bernd Eilert taucht wieder auf
Aber weiter in der Ausgabe der "FAZ". "Haus ohne Namen" heißt der Aufmacher der wiederbelebten Beilage "Bilder und Zeiten". Links oben: wieder ein Foto von Walser. Zusammen mit Walter Jens. Beide als NSDAP-Mitglieder. Im Zentrum der Geschichte aber steht ein Medienhaus in Oldenburg, das von einer früheren Redakteurin des Ortes gestiftet wurde und daher ihren Namen trägt. Bernd Eilert hat den Text recherchiert und geschrieben. Eilert, klingelt da was? Ja, der ist es. Eilert war zusammen mit Robert Gernhardt und Peter Knorr ein brillanter Autor und zu verehrender Kopf der Satirezeitschrift "Titanic", als die intellektuell ganz hochflog und nicht wie heute auf den Hund gekommen war.
Jedenfalls trägt dieses Medienhaus in Oldenburg (Eilert stammt auch von dort) nicht mehr den Namen von Edith Ruß. Diese hatte 1950, als sie Lehrerin werden wollte, bei ihrer Einstellung angegeben, nicht in der NSDAP gewesen zu sein. Später kam heraus: War sie eben doch. Eilert beschreibt die Diskussion in den Leserbriefspalten des Ortes feinsinnig und facettenreich. Es geht auch um "moralische Überlegenheit" von Nachgeborenen. Der Walser-Text im Feuilleton ist mit "Suada wider die moralische Korrektheit" überschrieben. Walser, Ruß. Zwei Fälle, ein Thema, eine "FAZ"-Ausgabe. Man kann diese geschätzten 600 Zeilen Eilerts nicht adäquat in einem Absatz zusammenfassen. Außer vielleicht mit dem Satz William Faulkners, den er auch zitiert: "Das Vergangene ist nicht tot; es ist noch nicht einmal vergangen."
Informationen, so gesund wie eine Tüte Chips
Und vergeht eben doch auf unverantwortliche Weise, wenn Bildung und Wissen und Wissbegier in einer besinnungslos-rauschhaften und eher an den Verzehr einer Chipstüte erinnernden Mediennutzung untergehen. "Snackable" nennt man verräterisch diese Form von bekömmlich aufbereiteter Seichtinformation und Berieselung mit belanglosem Zeug. "On demand", gewissermaßen. Auf Bestellung, per Klick. Und mit dem Heißhunger auf immer mehr davon. Wie bei den fetten Chips.
Das verklebt sogar Hirne in hochmögenden Redaktionen. Was hat sich der mediale Betrieb nicht am Weidel-Interview in der ARD abgearbeitet, nachdem es vom Akustik-Terror-Bus des sogenannten Zentrums für politische Schönheit niedergetönt wurde. Darf man das? Muss man das sogar? Hätte die ARD abbrechen müssen? Der kluge und geschichtsbewusste Funke-Verlagsmanager Tobias Korenke hat sich danach einer ganz anderen Frage gewidmet: Wie, schrieb er sinngemäß auf LinkedIn, kann man so geschichtsvergessen sein, die AfD-Frontfrau Alice Weidel am 20. Juli zu interviewen – ohne nicht wenigstens darauf Bezug zu nehmen? Antwort: Dafür müssten aber eben erst einmal sofort die Klingeln im Kopf klingeln, wenn das Datum aufgerufen wird.
Eilert zitiert in seinem Essay aus einer sogenannten MEMO-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft aus dem Jahr 2022, in der offenbar wird, dass die jüngere Generation aus diversen Gründen, nicht zuletzt aber wegen eines unseligen Mediennutzungsverhaltens entgegen Faulkners Diktum immer geschichtsvergessener wird: "Die Informationswege jüngerer Menschen verlaufen zunehmend über soziale Netzwerke und Plattformen wie YouTube, auf denen sowohl qualitativ hochwertige als auch geschichtsverzerrende Inhalte nebeneinanderstehen", heißt es da. "Nur ein kleiner Teil der Jugendlichen sucht gezielt nach seriösen Informationsquellen zum Thema Nationalsozialismus."
So schwindet das Wissen, und dessen Rudimente werden obendrein von Unfug durchsetzt. Auf eine etwas griffigere Formel hat dieses Phänomen der Wetterkundler Jörg Kachelmann in einem furiosen Interview in der "Bild"-Zeitung gebracht, ebenfalls am vergangenen Wochenende. Er wurde dort etwas scheinheilig gefragt, warum denn immer so viel Mist über das bevorstehende Wetter zu lesen sei. Kachelmann macht "ein, zwei Scharlatane" seiner Zunft dafür verantwortlich, die 90 Prozent der Medien bespielten. Weil sie die Mechanismen des Marktes befolgten. "Dumm klickt gut", konstatiert Kachelmann kurz und bündig. Man könnte auch in Anlehnung an den Dada-Hit "Banküberfall" der Ersten Allgemeinen Verunsicherung formulieren: Das Blöde ist immer und überall.
Und so konnte man am vergangenen Wochenende den Bogen schlagen: von der "FAZ" bis zur "Bild". Von Walser bis zum Wetter. Die Lektüre der "FAZ" hat alleine wegen der vier genannten Beiträge und noch einigem anderen Lesenswerten etwa zwei Stunden gedauert. Also viel länger als man braucht, um eine Tüte Chips in sich hineinzustopfen. Aber diese zwei Stunden machen nicht fett. Und man hat länger was davon.
- FAZ-Lektüre, "Bild"-Lektüre, eigenes Nachdenken, Vorkenntnisse