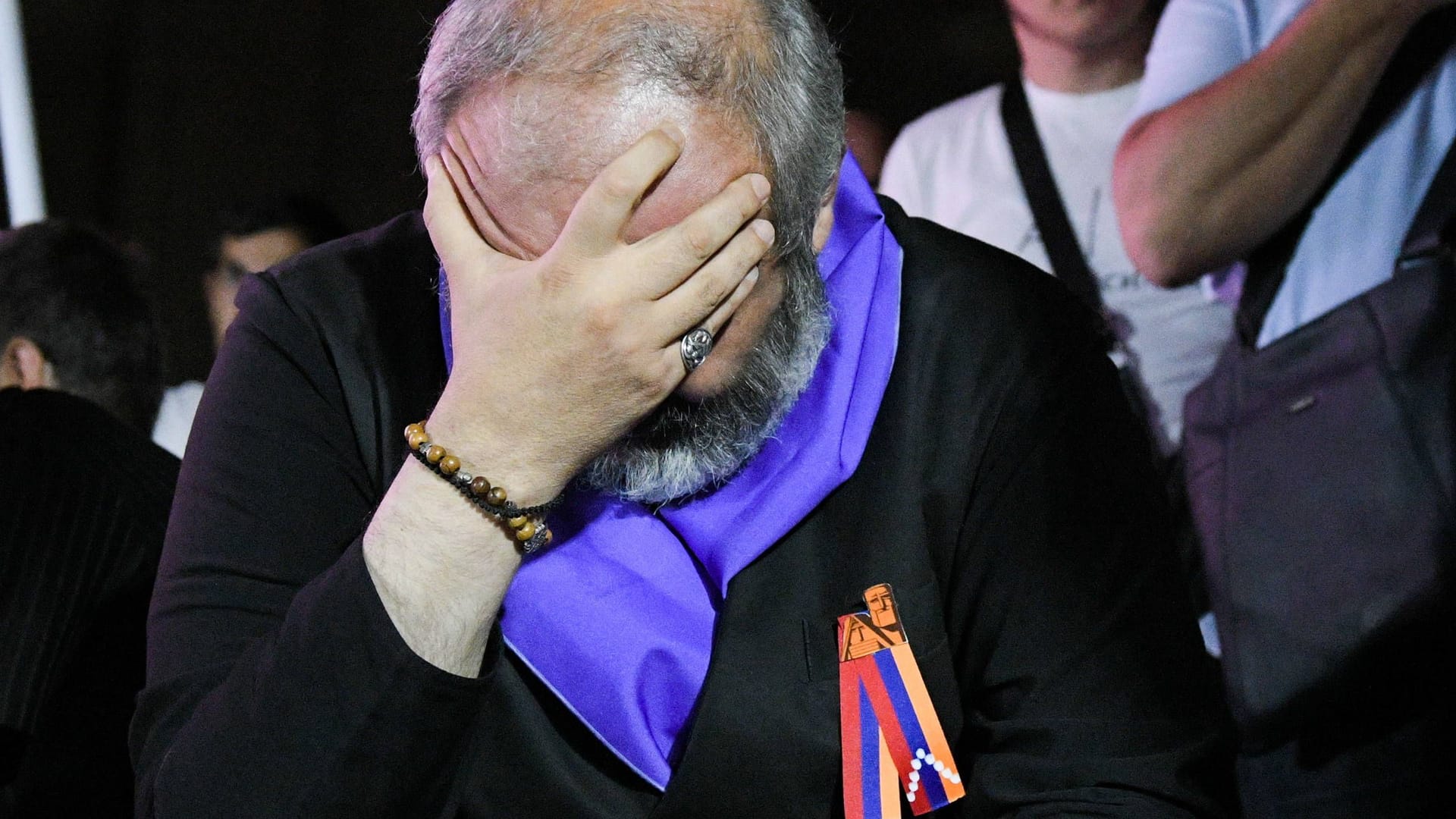Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ungewöhnliches Restaurant "Dass die uns für verrückt halten, nehme ich als Kompliment"


Das Watervale-Hotel sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Pub. Doch hinter der Fassade verbirgt sich eines der innovativsten Restaurants im australischen Clare Valley.
Warrick Duthy steuert in seinem Wagen auf das Watervale-Hotel zu. Mit Schwung parkt er in einer der Haltebuchten vor dem Haupteingang. "Sieht nach nicht viel aus, was?", sagt er und lacht. "Genauso mögen wir es hier!"
Tatsächlich ist das einstöckige Gebäude an der Schnellstraße zwischen Clare und Auburn in der Weinregion Clare Valley leicht zu übersehen. Ein flacher Eckbau mit viktorianischen Stilelementen und rotem Blechdach. Von außen ein Pub wie viele andere im trockenen Hinterland Australiens. Die Gesichter der Einheimischen am Tresen sehen in solchen Pubs meist genauso sparsam aus wie die Einrichtung. Die Zeit bleibt hier gerne mal stehen.
Nicht im Watervale-Hotel. Hinter der unscheinbaren Fassade befindet sich eines der innovativsten Restaurants Südaustraliens. Gemeinsam mit seiner Partnerin und Chefköchin Nicola Palmer hat Duthy den ehemaligen Pub vor sieben Jahren gekauft, von Grund auf renoviert und in eine Art Inkubator für nachhaltige Haute Cuisine verwandelt. Im Jahr 2023 wurde es von der renommierten Fachseite Corporate LiveWire zum Hotelrestaurant des Jahres in Australien gekürt. "Das war schon ein bisschen surreal", sagt Duthy. "Wir konnten es kaum glauben."
Das Konzept, das die beiden etabliert haben, lässt sich mit dem Etikett Farm-to-table (vom Bauernhof auf den Teller) nur unzureichend bezeichnen. Zwar kommt das meiste, das Palmer in ihrer Küche verwendet, von der eigenen Farm, doch die kulinarische Erfahrung geht weit über den biologischen Anbau von Lebensmitteln hinaus. Über die Philosophie seiner Gastronomie sagt Duthy: "Wir bieten epikureische Erlebnisse."
Der perfekte Säulenheilige der Slow-Food-Bewegung
Das muss man erst mal verdauen. Der griechische Denker Epikur war lange als hedonistischer Lustmolch verschrien. Heute liegen seine Weisheiten im Trend. Modernen Konsumkritikern gilt er als Schlemmer voller Lebensfreude, der an materiellem Reichtum nicht besonders interessiert war. Als Philosoph des achtsamen Genießens erfährt Epikur gerade weltweit eine Renaissance. Der alte Grieche scheint der perfekte Säulenheilige für die Slow-Food-Bewegung zu sein, die sich für eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Ernährung einsetzt.

Hotel oder Pub?
Wer in Australien in ein Hotel geht, sucht nicht zwangsläufig eine Schlafstätte. Hotel meint hier oft nur eine einfache Kneipe mit Bierausschank. Das hat historische Gründe. Wegen der traditionell strikten Regeln zum Alkoholverkauf im Land mussten Pubs (Kurzform für Public House) früher auch eine Schlafmöglichkeit anbieten, um überhaupt eine Schanklizenz zu erhalten. Ohne Bett, kein Bier, lautete die Vorschrift. Obwohl es diese Vorschrift längst nicht mehr gibt, ist der Name Hotel als Synonym für Pub dennoch geblieben.
Im Entree des Watervale-Hotels empfangen dunkle Holzböden und schwere Ledersofas im Manchester-Stil den Gast, die Wände ziert indigene Malerei, im Rückraum steht eine schlichte Bar, holzvertäfelte Separees gehen zu beiden Seiten des Ganges ab. Nichts Spektakuläres, aber wohltuend gemütlich.
Bodentiefe Fenster öffnen den Raum zum Innenhof, in dem ein mächtiger, gusseiserner Asado thront, ein argentinischer Grill. In der offenen Küche werkeln drei Köche konzentriert vor sich hin, es wird kaum gesprochen. Chefköchin Nicola Palmer arrangiert mit einer Pinzette die Teller. Die Atmosphäre hat nichts vom hektischen Treiben traditioneller Sterneküchen. In Palmers Küche ließe sich gut ein Buch lesen oder meditieren.
"Mein Ziel ist es, von den Produkten, die wir selbst anbauen, zu lernen", sagt Palmer. "Ich mag es, sie so optimal wie möglich zu präsentieren, unsere Lebensmittel sollen glänzen." Dieses Bewusstsein für Herkunft und Nachhaltigkeit kennzeichnet seit einigen Jahren den Ansatz vieler Spitzenköche. Regionalität und Identität gehen dabei eine Symbiose ein: "Ich will Lebendigkeit. Ich will Vielfalt. Das ist für mich moderne australische Küche", sagt Palmer. "Wir sind ein multikulturelles Land, und das soll man schmecken."
Wäre der Hund ein Philosoph, dann Epikur
Auch der australische Handelsminister Don Farrell schätzt Palmers Küche. Farrell sitzt für die Labor-Partei von Premierminister Anthony Albanese im Kabinett in Canberra, zu Hause ist er im Clare Valley. Der Minister schaut öfter im Watervale-Hotel vorbei. "Manchmal steht der in kurzer Hose und Flip-Flops an der Bar und unterhält die Leute mit seinen Geschichten", sagt Duthy. Der Hotelier erzählt davon, dass Farrell regelmäßig ausländische Staatsgäste anschleppt, die dann im Watervale-Hotel feiern.
Duthys Hund kommt angedackelt. Ein Staffordshire Bullterrier namens Frankie Blue. Der Hund setzt sich vor Duthy auf den Holzboden und macht große Augen. Das Stück hausgetrocknete Rinderleber, das Duthy aus der Tasche zieht, schmatzt Frankie Blue zufrieden, dann zieht er wieder ab. Wäre der Hund ein Philosoph, dann wohl Epikur.
Warum hat es der Philosoph des guten, ethischen Lebens Duthy so angetan? Auf der Penobscot-Farm findet sich die Antwort. Die Farm liegt ein paar hundert Meter weiter die Straße runter, ein wildes Stück Land gleich an der Straße, darauf ein unscheinbares Holzhaus, eingerahmt von Bäumen und Sträuchern. Hier leben Palmer und Duthy. Gemeinsam mit dem Permakultur-Experten Jared Murray kultivieren sie auf ihrer Farm alles, was auf den Tellern der Gäste landet. Dabei greifen sie auf die Philosophie Rudolf Steiners und das agrikulturelle Wissen der Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, Australiens indigener Bevölkerung, zurück. Angebaut werden Gemüse, Kräuter, Nüsse und Früchte nach streng biodynamischen, organischen und nachhaltigen Prinzipien. Immer im Einklang mit den natürlichen Zyklen der Natur.
Mitarbeiter des Monats: die "kleinen Leute"
Duthy nennt den Ansatz "holistisch". Alles hängt mit allem zusammen. Jedes Produkt, das in Palmers Küche ankommt, ist tief in den Mikrokosmos des Watervale-Hotels eingewoben. Nichts wird weggeworfen, nichts verrottet sinnlos, alles geht zurück in den natürlichen Kreislauf der Farm. Es wird viel fermentiert, kompostiert und evaluiert. "Wir haben es zu unserer Mission gemacht, der Erde dabei zu helfen, zu heilen", sagt Duthy. "Und wir bieten den Leuten Essen an, das reich ist an Nährstoffen, in dem Leben steckt. Unser Essen ist Medizin für den Körper."
Der gute Geist der Farm ist Auntie Angelena. Sie ist Mitte fünfzig und gehört dem Volk der Ngadjuri an, jener indigenen Gruppe, die in der Region rund um das Clare Valley lebt. Zu ihr geht Duthy häufig und fragt um Rat. Sie verfügt über einen unerschöpflichen Schatz agrikulturellen Wissens, der sich aus der 65.000 Jahre alten Erfahrung der Aboriginal Peoples im Umgang mit der Natur speist.
Dabei setzt Auntie Angelena wie ihre Vorfahren auf die Hilfe der "little people" ("kleinen Leute") – so nennen die Indigenen die Bewohner des Bodens, der aus unzähligen Mikroorganismen besteht, die im Erdreich arbeiten und es fruchtbar machen. Diese organische Charakteristik des Bodens ist wie ein biologischer Fingerabdruck. Ob genügend "little people" im Boden wohnen, bestimmt Auntie Angelena mit einem einfachen Test: Sie nimmt eine Handvoll Erde, stopft sie sich in den Mund und isst sie. Dann sagt sie Duthy, welchen Teil des Bodens er für die Arbeit auf der Farm gebrauchen kann.
Ein Terroir-Pfirsich von allerhöchster Güte
Ein wichtiger Bestandteil des Bodens ist das Myzel. Jenes sagenhafte Geflecht aus Pilzsporen, das den Untergrund der Erde bevölkert und sich in riesigen Netzwerken ausbreitet. Von Zeit zu Zeit bildet es sichtbare Auswüchse in Form von Pilzen. Das Myzel besitzt die Fähigkeit, den Boden mit Nährstoffen zu versorgen, ihn zu reinigen und mittels eines faszinierenden Netzwerks kommunizierender Röhren neues Leben zu erschaffen: das Geflecht aus feinen, weißen Fäden, den Hyphen, erschafft regelrechte "Brücken" zwischen den Pflanzen. Die Hyphen erlauben es den Pflanzen, regelrecht miteinander zu kommunizieren. Das Ergebnis lässt sich sehen: Auf der Farm gedeihen Zucchini, Kartoffeln, Granatäpfel, Haselnüsse, Wildblumen oder Kräuter wie Zitronenverbene und Borretsch, Birnen und Oliven prächtig, trotz des kargen Bodens.

Indigene Kulturtechniken
Laut neuer Untersuchungen könnte der moderne Mensch, Homo sapiens, schon vor 130.000 Jahren bis nach Australien gewandert sein und sich dort etabliert haben. In den zum Teil schwierigen klimatischen und geologischen Bedingungen des fünften Kontinents lernten die indigenen Völker Australiens, die nicht nur nomadisch lebten, sondern immer wieder auch sesshafte Perioden hatten, wie der Boden bestellt wird. Was von der Wissenschaft lange ignoriert wurde, inzwischen aber als gesichert gilt: Die Aboriginal Peoples entwickelten ausgefeilte landwirtschaftliche Techniken weit früher als die meisten anderen Menschen auf der Erde.
Selbstversuch mit einem Pfirsich beim Rundgang auf der Farm: Das Steinobst hängt schwer und saftig am Baum, es lässt sich bereitwillig pflücken. Beim Biss gibt die straffe, flaumige Haut der Frucht erst spät nach, offenbart dann aber eine Explosion sortentypischer Aromen, Anklänge von Rosenblüten, intensive Süße und eine gewisse Erdigkeit streicheln den Gaumen. Terroir-Pfirsiche, die später auf dem Teller im Watervale-Hotel landen. Im Watervale-Hotel rösten sie diese leicht an und servieren sie mit hausgemachtem Halloumi und einer intensiven Quittenemulsion.
"Das Problem ist ja folgendes", sagt Duthy. "Viele Köche und Gastronomen halten sich zugute, ethisch verantwortliche Produkte zu verwenden und nachhaltiges Essen anzubieten. Wenn das dann aber auf dem Teller liegt und es schmeckt nach nichts, dann hast du rein gar nichts bewiesen. Dann inspirierst du niemanden." Ihm gehe es in erster Linie nicht um eine Ideologie, sondern um leckeres Essen. "Und weil es gut schmeckt, können wir auch noch unsere Botschaft 'rüberbringen."
Landwirtschaft nach dem Prinzip: Abwarten
Duthy düngt auf der Penobscot-Farm lediglich mit selbst hergestelltem Kompost, der mit unbestellter Erde von anderen Orten des Ngadjuri-Lands "geimpft" wird, wie er erklärt. Auf die Art würden die "kleinen Leute" in die neue Erde eingebracht. Eine indigene Technik. Nach der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners wiederum werden im Winter mit Kieselsäure gefüllte Kuhhörner im Boden vergraben und das nach Monaten des Wartens entstandene Düngepräparat im Frühjahr verteilt. Um die Wachstumsprozesse von Gemüsepflanzen zu beschleunigen, liegen dunkle Plastikfolien auf den Saatreihen. Eine sehr moderne Maßnahme.
Auf diese ungewöhnliche Mischung unterschiedlicher Weltanschauungen und agrikultureller Techniken schwört Duthy. Er sagt, seine Partner und er arbeiteten auf der Farm vor allem nach dem Prinzip: abwarten. "Biodynamische Bauern sind notorisch faul", sagt er mit Verweis auf die "kleinen Leute", die schon seit Jahrtausenden im Boden stecken und ihn fruchtbar machen. "Warum sollen wir denn die ganze Arbeit selbst erledigen, wenn es auch jemand anders machen kann?"

Endemisches Biom
In Südaustralien, das eine Fläche so groß wie Frankreich und Deutschland zusammen umfasst, gibt es drei ökologische Großzonen. Die Gegend um die Hauptstadt Adelaide, zu der auch das Clare Valley gehört, ist geprägt vom ariden und mediterranen Biom, also der Biosphäre einer bestimmten Region. Die Böden bestehen häufig aus rotbraunem, sandigem Lehm, die Tage sind heiß, die Nächte mitunter kalt bis frostig. Niederschläge sind selten. Derzeit herrscht in der Region eine historische Trockenheit: Seit 1910 ist dort nicht mehr so wenig Regen gefallen wie seit dem vergangenen Jahr.
Pseudowissenschaft und magisches Denken?
Es geht auf der Penobscot-Farm darum, natürliche Prozesse so optimal wie möglich auszunutzen. Wichtig für den Erfolg dieses Ansatzes ist die sorgfältige Zusammenstellung der Pflanzen, die gepflanzt und geerntet werden, immer im Einklang mit dem Mondkalender und den natürlichen Kreisläufen des Ökosystems. Von den Vertretern der konventionellen Landwirtschaft erntet dieser Ansatz häufig Kritik, ähnlich wie die Demeter-Bewegung in Deutschland, sehen sich Bauern wie Duthy dem Vorwurf der Pseudowissenschaft und des magischen Denkens ausgesetzt.
"Lass uns ehrlich sein, die meisten Leute hier in der Gegend halten uns wahrscheinlich für verrückt, die denken, wir spinnen", sagt Duthy. "Aber das nehme ich als Kompliment. Uns ist es ernst damit, eine authentische, anspruchsvolle Küche anzubieten, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen respektiert und gleichzeitig gut für den Körper ist." Und wer sagt, dass ein wenig magisches Denken dabei nicht von Vorteil sein könnte?
Der Gastronom und Biobauer Duthy setzt ganz bewusst auf die Erkenntnisse der Aboriginal Peoples – ein ungeheurer Wissensschatz, der bis heute nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft ist. Dieser mag mit westlichen Kriterien nicht immer zu fassen sein, aber er wird seit nunmehr 65.000 Jahren angewandt und perfektioniert. Und wen das nicht überzeugt, der möge einmal in einen Pfirsich von der Penobscot-Farm beißen.

Clare Valley
Das Clare Valley zählt neben dem Eden Valley und dem Barossa Valley zu den besten Weinanbaugebieten in Südaustralien. Es ist außerdem bekannt als Region für Feinschmecker. Flüge von Frankfurt/M. nach Adelaide ab 1.300 €. Von dort per Mietwagen ins Clare Valley (ca. eine Stunde Fahrt). Unterkunft z.B. auf der Penabscot Farm ab 700 € pro Nacht (inklusive Degustationsmenü und Touren) oder in den Clare Hillside Apartments (ab 220 € pro Nacht). Abendessen im Watervale-Hotel (moderne australische Küche) oder im Ragu&Co (italienisch). Gutes Frühstück im Café 1871 oder auch im Antidote Kitchen.
Transparenzhinweis: Die Reise wurde unterstützt von der südaustralischen Tourismusbehörde Tourism South Australia.
- Eigene Recherche und Gespräche vor Ort
- anbg.gov.au: The mycelium
- watervalehotel.com.au: our farm
- therealreview.com: The (Bio)Dynamic Steph and Jeff show
- faz.net: Entrüstung über Demeter
- epa.sa.gov.au: Overview of South Australia’s environment
- midlandhotel.com.au: What is an Hotel? And why are Pubs called Hotels in Australia?
Quellen anzeigen