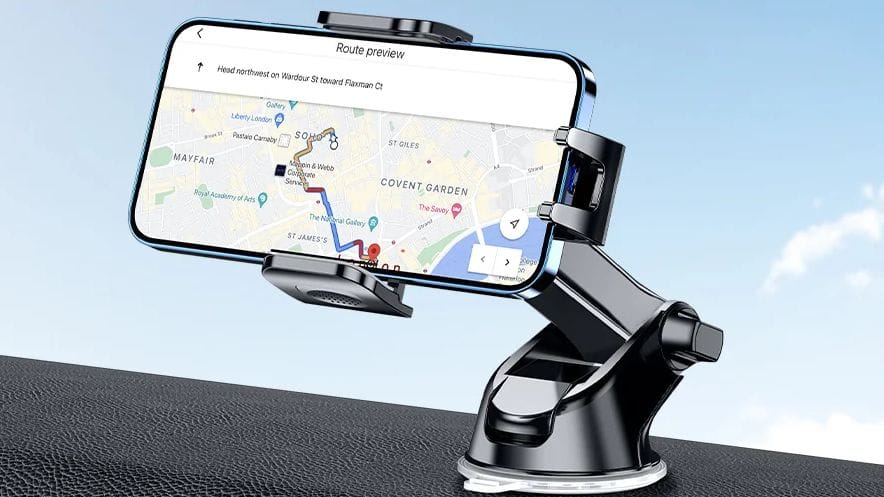Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Künstliche Intelligenz "Europa muss jetzt handeln – oder es zerbricht"


Die Branche für Künstliche Intelligenz steht vor großen Herausforderungen. Amerika und China setzen Europa unter Druck. Einer der führenden Experten erklärt im Interview, wie Deutschland sich aus dem Würgegriff befreien kann.
Künstliche Intelligenz ist in vielen Bereichen und Branchen auf dem Vormarsch. In Schulen kämpfen Lehrer gegen ChatGPT-generierte Aufsätze, Unternehmen integrieren KI-Tools in ihre Abläufe, und selbst Behörden können sich der digitalen Welle nicht mehr entziehen.
Fabian Westerheide ist einer der profiliertesten KI-Investoren Deutschlands. Er ist Gründer der "Rise of AI", einer jährlichen Konferenz für führende Köpfe der KI-Szene, die am 14. Mai in Berlin stattfand. Das diesjährige Motto lautete: "Good News from Europe" – in einer Zeit, in der der europäische Technologiesektor oft als hoffnungslos abgehängt gilt.
Im Gespräch mit t-online erklärt Westerheide, warum er trotz aller Herausforderungen an Europa glaubt und welche deutschen KI-Unternehmen vielversprechend sind.
t-online: Herr Westerheide, wie sehr hat Künstliche Intelligenz Ihre tägliche Arbeit verändert?
Fabian Westerheide: Sehr. Ich benutze allein ChatGPT bis zu 50-mal am Tag. Manchmal auch 30-mal hintereinander bei einer Frage, weil ich prompte, diskutiere und die Ergebnisse immer weiter verfeinere. Für mich ist KI wie ein Praktikant: Am Anfang kann sie nichts, du musst sie anleiten und ihre Arbeit kontrollieren. Aber mit der Zeit nimmt sie dir immer mehr Arbeit ab. Früher hätte ich Texte für mein Buch zu einem Lektor schicken und dann ein, zwei Tage auf Feedback warten müssen – jetzt bekomme ich es sofort. Das ist unglaublich wertvoll.
Vor drei Jahren war ständig von ChatGPT die Rede. Inzwischen scheint es so, als sei der Hype abgeflaut. Oder täuscht der Eindruck?
Das täuscht. Lediglich der mediale Hype flacht ab, die öffentliche Aufmerksamkeit ist gesättigt – nach dem Motto: "Wir haben es jetzt, fertig." Dabei fängt die eigentliche Arbeit erst an: Was ist mit Schülern, die ChatGPT für Aufsätze nutzen? Die Lernergebnisse gehen runter. Wir müssen jetzt die Bildung anpassen. Zugleich steigt in der Industrie der Bedarf. Es gibt mehr Aufträge. Denn diese Tools müssen in Unternehmen und Behörden integriert werden.

Zur Person
Fabian J. G. Westerheide gilt als einer der führenden Köpfe im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Deutschland. Als Gründer und CEO der AI for Humans GmbH ist er Berater zahlreicher Regierungsinstitutionen und Fortune-500-Unternehmen. Zudem ist er Gründungspartner des KI-fokussierten Venture Capital-Investors AI.FUND. Zusammen mit seiner Frau ist er Gastgeber der jährlichen Konferenz "Rise of AI", dem Branchentreffen für die zentralen Akteure der deutschen KI-Szene.
Wie gut sind deutsche Unternehmen dafür positioniert?
Wir haben in Europa alles, was wir brauchen – viele gute Lösungen. Es gibt wenig Grund, amerikanische oder chinesische Produkte zu kaufen. Aber die sind halt schneller, günstiger und aggressiver. Wenn wir nicht handeln, werden bald nur noch Microsoft-Produkte genutzt, die ihre KI überall integrieren. Ich möchte, dass deutsche Firmen wieder eigene Produkte entwickeln. Nehmen Sie SAP, ein internationaler Softwarekonzern aus Deutschland: Sie bilden das Rückgrat einer jeden Firma, denn sie verfügen über alle Datenströme. Das Unternehmen müsste eigentlich die mächtigste Firma der Welt sein. Könnte es auch sein. Aber wie viele deutsche Unternehmen ist SAP orientierungslos.
Trotzdem lautet das Motto Ihrer Konferenz "Good News from Europe" – gute Nachrichten aus Europa. Was sind denn die guten Nachrichten?
Wir haben eine funktionierende Demokratie und verlässliche Planbarkeit in unseren Strukturen. Europa ist der Ort, wo immer mehr Menschen sein wollen. Ich habe mit mehreren Amerikanern gesprochen, die lieber in Berlin leben als in den USA. Hier ist "the place to live". Wir werden sogar mehr zum Garanten für Stabilität und Sicherheit.
Was macht Sie so optimistisch, angesichts der oft beschriebenen technologischen Rückständigkeit Europas?
Europa und die deutsche Verwaltung reagieren traditionell erst, wenn der Druck groß genug ist. Die Amerikaner bauen Druck auf, die Chinesen sehen das und handeln präventiv – und wir reagieren. Aber jetzt wird der Druck so groß, dass Europa handeln muss. Die nächsten Monate oder Jahre werden entscheidend: Können wir unser Potenzial entfalten – die Vielfalt, die Kultur, die Talente? Oder zerbricht Europa, weil es gespalten wird? Für mich ist es eine gute Nachricht, dass der Druck jetzt so groß ist, dass Europas Eliten endlich agieren müssen.
Was erwarten Sie vom neuen Digitalminister Karsten Wildberger?
Der Vorteil ist, dass es ein neues Ministerium ohne Altlasten ist – sie können sich dort neu austoben. Und Wildberger ist ein Externer, nicht durch den Parteiklüngel ins Amt gekommen, sondern wegen seiner Kompetenzen. Das ist doch erst mal großartig: einen Minister zu haben, der nicht auf irgendeiner Liste stand, sondern Kompetenz mitbringt.
Wildbergers Bilanz als Chef von Media Markt und Saturn fällt allerdings nicht nur positiv aus.
Wollen wir ihn wirklich anhand von zwei Jahren beurteilen? Ich habe intern gehört, dass er ein guter Chef sein soll, der Dinge bewegt, Druck aufbaut und fordert. Wenn man sich die Ministerien der letzten Regierung anschaut – manche waren führungslos und schwach, andere haben viel bewegt, einige waren komplett fehlbesetzt. Robert Habeck ist ein toller Mann, war aber ein schlechter Wirtschaftsminister, weil das nicht sein Ressort war. Es ist wichtig, dass die richtige Person im richtigen Amt sitzt.
Und jetzt haben wir die richtigen Personen?
Im Digitalministerium haben wir jetzt zumindest Leute, die das Thema verstehen. Thomas Jarzombek, unser neuer Staatssekretär, besucht seit zehn Jahren die "Rise of AI"-Konferenz. Ist es nicht genau das, was wir wollen? Dass Menschen mit Kompetenz politische Macht ausüben? Ich hätte auch gerne einen Verteidigungsminister, der beim Militär war, oder einen Gesundheitsminister, der Arzt ist. Ich habe erst einmal gute Hoffnung, erwarte aber keine Wunder. Die Probleme sind einfach zu groß.
Welche sind das Ihrer Meinung nach?
Dass der Staat – insbesondere die Verwaltung – noch nicht digital denkt und deswegen auch keine digitalen Prozesse anbietet. Es braucht ein kulturelles Umdenken und einen systematischen Umbau. Man kann ja nicht einfach Papier und Formulare durch PDFs und Webseiten ersetzen. Der neue Digitalminister muss also verkrustete Strukturen aufbrechen und durch neue Lösungen ersetzen. Was ich bisher aus dem sehr jungen Ministerium gehört habe, ist, dass es eher wie ein Start-up agiert – das finde ich sehr interessant und spannend. Ein anderes Problem ist der Mangel an Vernetzung, jedes Bundesland hat seine eigenen Lösungen. Das führt zu ungemein viel Bürokratie.
Wie bewerten Sie den AI Act – das europäische KI-Gesetz: Ist er förderlich oder eher hinderlich?
Für mich sind es gute Intentionen, aber falsch umgesetzt. Ich sage immer: Lasst das Ökosystem die Standards regeln. In dem Fall kommt aber erst ein Gesetz, das versucht, alles zu definieren. Die EU ist sehr übergriffig und agiert aus einer Verteidigungsstrategie heraus: Wir haben selbst keine Industrie, also versuchen wir, die bestehende US-Industrie zu blockieren.
Wäre es nicht aber wichtig, Tech-Giganten wie Meta oder Google zu regulieren?
Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, diese Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen – allein schon, weil sie kaum Steuern zahlen. Sie verdienen Hunderte Milliarden mit unseren Daten, davon will ich unseren Teil haben. Aber die EU-Strategie mit Geldstrafen führt dazu, dass wir nur die Produkte zweiter Klasse bekommen. Die wirklich innovativen Produkte erreichen uns nicht mehr, denn die Unternehmen fürchten, verklagt oder gerügt zu werden – und wir haben nur das Internet zweiter Klasse.
Erst kürzlich hat die Verbraucherzentrale Meta wegen der Nutzung persönlicher Daten zu Trainingszwecken verklagt. Sehen Sie auch solche Klagen kritisch?
Ich unterscheide zwischen Privatsphäre und Datenschutz. Die Privatsphäre sollte geschützt werden. Aber unsere Daten sind praktisch frei, sobald wir digital aktiv sind – ein Foto machen, etwas posten. OpenAI wurde verklagt, weil sie Bücher zum Training verwendet haben, und die Verlage fordern nun Geld. Aber warum? Soll KI doch Bücher lesen und daraus lernen. Wissen sollte kostenfrei und jedem zugänglich sein.
Aber müsste dann die Nutzung von ChatGPT nicht auch kostenfrei sein? Immerhin verdienen sie viel Geld mit diesem Material...
ChatGPT ist kostenlos – 97 Prozent nutzen es ohne zu bezahlen. Das Wissen ist jedem verfügbar, auch über andere Anbieter wie Google und Anthropic. Wer mehr Leistung möchte, zahlt freiwillig dafür. Die Frage bleibt, ob es richtig ist, dass private Firmen mit dem Wissen der Menschheit Geld verdienen. Doch auch Verlage tun dies durch Aufbereitung. ChatGPT erbringt enorme Wissensaufbereitung, während die Firma täglich Verluste macht, finanziert von Privatinvestoren. Wir können nicht Verluste auf Kapitalgeber abwälzen und Gewinne verschenken. Eine spannende Diskussion für die kommenden Jahre.
Wie werden kreative Berufe sich durch Künstliche Intelligenz verändern?
Die Geschäftsmodelle müssen sich anpassen. Was haben Musiker gemacht, als Streaming-Plattformen aufkamen? Sie werden zwar über die Tantieme für Abrufe beteiligt, aber sie verkaufen seitdem kaum noch Platten. Womit verdienen sie also Geld? Vor allem mit ihrer Marke, mit Konzerten. Das Menschliche bringt wieder mehr Geld, nicht nur die Musik selbst.
Aber kleinere Künstler gehen dabei doch unter, oder?
Schaut man in die Geschichtsbücher, haben sich Künstler schon immer beschwert. Alle denken, wir hätten jetzt ein besonderes Problem, aber das gab es immer schon – nur hatten wir früher keine so umfassende Subventionsindustrie. Berlin kürzt gerade Kulturgelder, das ist für die Betroffenen schlimm. Aber kollektiv müssen wir uns fragen: Wie viel können wir uns leisten?
Die Frage ist doch eher: Wie viel ist uns Kultur wert?
Ein Abgeordneter sagte mir: Sie kürzen dort, wo sich niemand beschwert. Wenn drei Millionen bei der Quantenforschung gestrichen werden, merkt das kaum jemand. Wenn aber 100.000 Euro für ein Open-Source-Projekt fehlen, gibt es einen Shitstorm von 500 Ehrenamtlichen. Was wird also gemacht? Nicht die sinnvolle, sondern die politisch kalkulierte Entscheidung. Individuell ist das tragisch, aber kollektiv können wir uns das alles nicht leisten. Wir müssen die Militärausgaben verdreifachen, haben eine Rentenwelle vor uns, Probleme im Gesundheitssystem und bei der Pflege – und nichts davon wird angegangen. Stattdessen streiten wir über Künstler und Datenschutz.
Was nehmen Sie von der diesjährigen "Rise of AI"-Konferenz mit?
Dass die Menschen gute Nachrichten aus Europa hören wollen. Sie suchen nach einem Aufbruch, wollen hören, dass alles gut wird. Das meiste positive Feedback bekam ich für mein Bekenntnis zu Europa. Derzeit sagt das kaum jemand – wir sind alle in unserer Selbstkritik gefangen. Aber ich bin stolz, Deutscher zu sein. Es ist ein tolles Land mit einer großartigen Kultur. Natürlich kritisiere ich Regierung und Verwaltung, aber nur, weil sie es nicht so gut machen, wie wir es bräuchten.
In der Öffentlichkeit sprechen wir oft nur über ChatGPT und Co. Welche wichtigen KI-Entwicklungen bleiben dabei unter dem Radar?
Gute KI ist unsichtbar. Man bemerkt sie nicht einmal. Die meiste KI regelt den Verkehr oder bearbeitet Anträge. Sie prüft jede Kreditkartentransaktion auf Betrug. Dann erst meldet sich ein Mensch und fragt: "War diese Buchung von Ihnen?" Gute KI bleibt im Hintergrund – wir bemerken sie nur, wenn sie Fehler macht. Zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos: Niemand spricht darüber, dass sie weniger Unfälle verursachen als Menschen. Aber sobald ein Unfall passiert, beschweren sich alle.
Könnte die kulturelle Prägung von KI-Systemen zu Problemen führen?
Die großen Sprachmodelle sind kulturell geprägt: OpenAI denkt amerikanisch, DeepSeek chinesisch. Wenn ich ein chinesisches Modell integriere, bekomme ich chinesische Ergebnisse – nicht mehr deutsche. Deshalb ist es wichtig, eigene Modelle zu trainieren, oder wir nehmen amerikanische Modelle und passen sie an. Gerade in Europa und Deutschland haben wir tolle Beispiele: Unternehmen, die sich auf Krebsfrüherkennung spezialisieren, präventive Maschinenwartung anbieten oder Geldwäscheprüfungen durchführen.
Welche deutschen Unternehmen stechen besonders hervor?
Da gibt es viele Beispiele: Aleph Alpha gilt als deutscher Hoffnungsträger im Bereich generativer KI. Das Fraunhofer-Institut in Dresden entwickelt OpenGPT, ein KI-Sprachmodell, das sich an europäischen Bedürfnissen, Werten und Datenschutzanforderungen ausrichtet. DeepL ist bekannt für seine Übersetzungen. Helsing und Quantum Systems arbeiten an militärischer Überwachung, Black Forest Labs spezialisiert sich auf KI-Bildgenerierung.
Woher kommt diese Innovationskraft?
Interessanterweise haben fast alle dieser Gründer Erfahrungen im amerikanischen Tech-Ökosystem gesammelt. Beim Marktführer lernt man am besten – und gründet dann selbst ein Unternehmen. Aus Google und Apple sind viele Firmen entstanden, weil die Mitarbeiter das Gelernte genutzt haben, um es besser oder schneller zu machen.
Herr Westerheide, vielen Dank für das Gespräch.
- Interview mit Fabian J. G. Westerheide