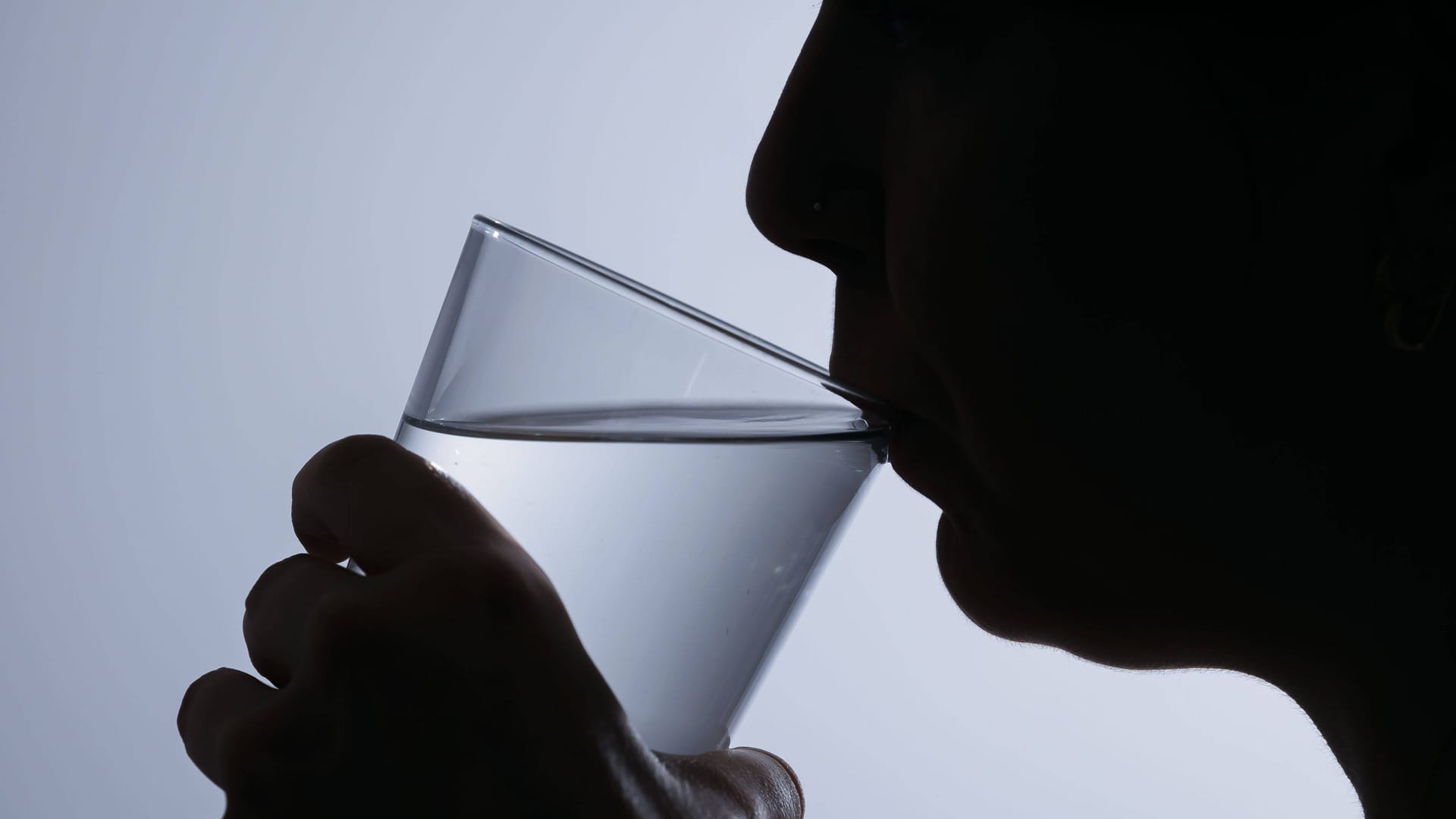Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Wenn die Linse eintrübt Grauer Star ist nur per Katarakt-OP behandelbar


Grauer Star lässt sich per OP behandeln. Wir informieren Sie über die Kosten des Eingriffs, mögliche Probleme danach und die Auswahl der richtigen Linse.
Grauer Star (Fachbegriff: Katarakt) ist eine meist altersbedingte Eintrübung der Augenlinse. Wird er nicht operiert, kann sich das Sehen zunehmend verschlechtern – im Extremfall bis hin zur Erblindung. In Deutschland und anderen Industrieländern passiert das jedoch dank der hier verfügbaren Katarakt-OP selten.
In Deutschland ist grauer Star der häufigste Grund für eine OP überhaupt. Jedes Jahr entscheiden sich hierzulande etwa 700.000 Menschen für eine Katarakt-OP. Meist verläuft die Operation sehr erfolgreich: Über 90 Prozent der Betroffenen können danach wieder deutlich besser sehen.
Grauer Star: Wann operieren?
Wann Sie grauen Star operieren lassen sollten, hängt vor allem von dessen Auswirkungen ab. Die Linsentrübung allein ist noch kein Grund für eine Katarakt-OP. Erst wenn ein grauer Star im Alltag Probleme bereitet, ist eine OP sinnvoll.
Darum ist es ratsam, sich regelmäßig augenärztlich untersuchen zu lassen. Dabei können Sie direkt mit Ihrer Augenärztin oder Ihrem Augenarzt besprechen, wann der richtige Zeitpunkt ist, den grauen Star zu operieren.
Normalerweise hat der Zeitpunkt der Katarakt-OP keinen Einfluss auf deren Ergebnis. Darum ist meist der persönliche Wunsch ausschlaggebend für den OP-Termin. Manchmal ist es aber aus medizinischen Gründen ratsam, grauen Star möglichst schnell operieren zu lassen. Zum Beispiel, wenn
- eine Augenverletzung zu einer Linsenquellung führt
- der Augenhintergrund erkrankt ist, sich aber wegen der Katarakt schlecht kontrollieren lässt
- der graue Star im Endstadium einen plötzlichen starken Anstieg des Augeninnendrucks verursacht (Glaukomanfall bzw. akuter grüner Star)
Wichtiger Hinweis
Auch ein angeborener grauer Star erfordert eine frühzeitige OP: Nur so lässt sich verhindern, dass die betroffenen Babys eine dauerhafte Sehschwäche entwickeln.
Wie läuft die Katarakt-OP ab?
Beim grauen Star besteht die Operation darin, die trübe Linse zu entfernen und durch eine künstliche Linse zu ersetzen. Meist findet die Katarakt-OP unter örtlicher Betäubung statt: Das Betäubungsmittel kann neben das Auge gespritzt oder als Augentropfen ins Auge gegeben werden.
Das bei grauem Star am häufigsten angewendete OP-Verfahren heißt Phakoemulsifikation: Dabei entfernt die Augenärztin oder der Augenarzt nur den Kern und die Rinde der Linse. Die Kapsel, die die Linse umschließt, bleibt im Auge. So läuft die Operation ab:
- Als Erstes wird ein kleiner Schnitt am Rand der Hornhaut gemacht.
- Dann wird eine kleine scheibenförmige Öffnung vorn in die Linsenkapsel geschnitten.
- Über diesen Zugang wird der Linsenkern per Hochfrequenzultraschall verflüssigt und zusammen mit der weicheren Linsenrinde abgesaugt.
- Zum Schluss wird eine künstliche Linse in die verbliebene Kapsel eingesetzt.
Beeinträchtigt ein grauer Star das Sehvermögen beidseitig, ist es üblich, zunächst nur ein Auge zu operieren. Die Katarakt-OP dauert dann etwa 20 bis 30 Minuten. Der Eingriff am anderen Auge findet später nach ärztlicher Absprache statt.
Wenn nichts dagegen spricht, erfolgt die Katarakt-OP in der Regel ambulant. Dann können Sie schon einige Stunden nach dem Eingriff wieder nach Hause. Manchmal ist es aber sinnvoller, grauen Star im Krankenhaus operieren zu lassen. Zum Beispiel, wenn Sie wegen einer Erkrankung eine intensivere Betreuung brauchen.
Grauer Star: Welche Linse ist die richtige?
Die bei der Katarakt-OP ins Auge eingesetzte künstliche Linse heißt fachsprachlich Intraokularlinse (das lateinische Wort "oculus" bedeutet "Auge"). Es gibt verschiedene Linsentypen, zum Beispiel:
- Monofokallinsen, die nur einen festen Brennpunkt haben, sodass scharfes Sehen nur entweder in der Nähe, in der Ferne oder in einem Bereich dazwischen möglich ist
- Multifokallinsen, die dank mehrerer Brennpunkte – ähnlich wie Gleitsichtbrillen – sowohl in der Ferne als auch in der Nähe für ein scharfes Bild sorgen
- torische Linsen, die eine bestehende stärkere Hornhautverkrümmung ausgleichen
- Blaufilterlinsen, die Blaulicht filtern und so womöglich die Netzhaut vor Erkrankungen schützen
- EDoF-Linsen mit erweiterter Tiefenschärfe (EDoF = Extended Depth of Focus), sodass – ähnlich wie bei Multifokallinsen – scharfes Sehen in der Nähe (allerdings maximal bis etwa zum üblichen Bildschirmabstand) sowie in der Ferne möglich ist
Bevor grauer Star operiert wird, stellt sich also die Frage, welche Linse die richtige ist. Jeder Linsentyp hat Vor- und Nachteile. So müssen Sie bei der Monofokallinse vor der Katarakt-OP festlegen, in welchem Bereich Sie später scharf sehen möchten. Für die anderen Bereiche benötigen Sie dann nach der Operation eine Brille.
Hingegen können Sie mit einer Multifokallinse zwar in allen Entfernungen gleich gut sehen, sodass Sie nach der Katarakt-OP womöglich keine Brille brauchen. Allerdings ist das Bild insgesamt etwas kontrastärmer und kann in manchen Bereichen verschwommen bleiben. Zudem kommt es bei diesem Linsentyp vermehrt zu Blendungen durch Licht, etwa beim nächtlichen Autofahren.
Gut zu wissen
Je nachdem, welche Linse Sie zur Behandlung des grauen Stars auswählen, können Kosten für Sie anfallen: Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen die Katarakt-OP nur dann vollständig, wenn Sie eine Monofokallinse erhalten. Bei allen anderen Linsentypen ist das Material und teils auch das Einsetzen teurer. Diese Mehrkosten müssen Sie aus eigener Tasche bezahlen.
In jedem Fall ist es ratsam, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Linsentypen gut abzuwägen. Wenn Sie trotz Beratung durch Ihre Augenärztin oder Ihren Augenarzt noch unsicher sind, welche Linse die richtige für Sie ist, können Sie vor der Katarakt-OP auch eine fachärztliche Zweitmeinung einholen.
Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.
Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.
Übrigens ist der Linsentyp allein nicht entscheidend für das OP-Ergebnis bei grauem Star. Wichtiger ist, dass die Linse bestmöglich an Ihr Auge angepasst ist und die richtige Stärke hat. Um diese zu berechnen, wird die Augenärztin oder der Augenarzt Ihre Augen vor der Katarakt-OP gründlich untersuchen und vermessen.
Schon gewusst?
Meist hält die eingesetzte künstliche Linse ein Leben lang. Sie kann weder verschleißen noch eintrüben. Nach der ersten OP ist darum normalerweise kein weiterer Linsenaustausch nötig.
Grauer Star: Wie geht es nach der OP weiter?
Ein operierter grauer Star erfordert eine sorgfältige Nachbehandlung. Um das operierte Auge zu schützen, wird es nach der OP mit einem Verband abgedeckt. Wie lange Sie den Augenverband tragen sollten, wird Ihnen die Augenärztin oder der Augenarzt sagen.
In den ersten Tagen nach der Katarakt-OP kann das operierte Auge jucken und/oder leicht wehtun. Vermeiden Sie es aber unbedingt, das Auge fest zu berühren oder zu reiben. Manchmal entsteht auch vorübergehend ein Fremdkörpergefühl im Auge. Doch meist sind solche Beschwerden bald wieder verschwunden.
Besonders wichtig bei der Nachbehandlung von grauem Star sind die Augenmedikamente, die Sie für die Zeit nach der OP verordnet bekommen: Wenden Sie die Augentropfen und/oder -salben auf jeden Fall wie angewiesen an.
Außerdem ist es nach der Katarakt-OP unerlässlich, das operierte Auge regelmäßig ärztlich kontrollieren zu lassen. Ratsam sind solche Nachsorgetermine:
- in den ersten Tagen nach der OP meist täglich
- in den folgenden beiden Monaten in größeren Abständen
- bei auftretenden Komplikationen kurzfristig
- zur Anpassung der ersten Sehhilfe ca. drei Wochen bis drei Monate nach der OP
- nach Versorgung mit geeigneten Sehhilfen ungefähr einmal jährlich
Die meisten Alltagstätigkeiten können Sie einige Tage nach der Katarakt-OP wieder wie gewohnt ausführen. Wie lange Sie nach der Operation des grauen Stars krankgeschrieben sind und wann Sie wieder Auto fahren dürfen, hängt von Ihrer Sehschärfe nach der OP ab.
Zwar verbessert sich das Sehvermögen oft schon am ersten Tag nach der Operation. Doch die endgültige Sehschärfe ist erst einige Wochen nach der Katarakt-OP erreicht. Frühestens dann ist es möglich, bei Bedarf Brillengläser zur Korrektur der Sehschärfe anzupassen.
Können nach der Katarakt-OP Probleme auftreten?
Grauen Star per OP zu behandeln gilt als sehr sicher. Trotzdem können danach Probleme auftreten. Die häufigste Komplikation nach der Katarakt-OP ist der sogenannte Nachstar: Dann trübt die im Auge verbliebene hintere Linsenkapsel ein, sodass sich das Sehen wieder verschlechtert.
Meist entwickelt sich ein Nachstar drei bis sechs Monate nachdem der graue Star operiert wurde, manchmal auch erst Jahre später. Er ist mit einem Laser behandelbar. Weitere mögliche Probleme nach der Katarakt-OP sind:
- Schwellung der Netzhaut
- Verschiebung der Linse
- Netzhautablösung
- Entzündung des Augeninneren
Die meisten Komplikationen, die nach der OP eines grauen Stars auftreten können, haben keine dauerhaften Folgen. Sie können aber vorübergehend Beschwerden verursachen oder die Heilung des operierten Auges verlangsamen. Manchmal erfordern sie auch eine Behandlung mit Medikamenten oder eine erneute Augen-OP.
- Online-Informationen des Pschyrembel: www.pschyrembel.de (Abrufdatum: 29.6.2021)
- Katarakt (Grauer Star). Online-Informationen von AMBOSS: next.amboss.com (Stand: 14.12.2020)
- Grauer Star (Katarakt). Online-Informationen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): www.gesundheitsinformation.de (Stand: 25.9.2019)
- Katarakt. Online-Informationen von Deximed: deximed.de (Stand: 18.2.2019)
- Patientenbroschüre des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA) und der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) (Hrsg.): Staroperation und Intraokularlinse (PDF). Online-Informationen des BVA: www.augeninfo.de (Stand: 2015)
- Leitlinie Nr. 19 von BVA und DOG: Katarakt (Grauer Star) im Erwachsenenalter (PDF). Online-Informationen des BVA: www.augeninfo.de (Stand: 11.1.2012)
- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.
Quellen anzeigen