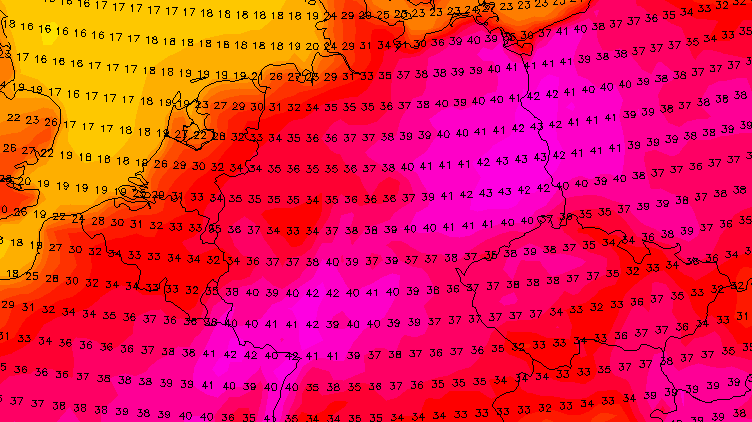Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ersthelferin berichtet nach Messerangriff "Er machte drei oder vier tiefe Atemzüge – seine letzten"


Messerangriffe und der Umgang mit ihnen bestimmen aktuell die Debatten in Deutschland. t-online hat mit einer Ersthelferin über die Auswirkungen auf Dritte gesprochen.
Täglich wird über neue gewaltsame Übergriffe im öffentlichen Raum berichtet. Immer häufiger werden dabei Messer als Tatwaffe verwendet. In Nordrhein-Westfalen stiegen die Angriffe mit Messern zwischen 2022 und 2023 beispielsweise um 43 Prozent, wie Innenminister Reul (CDU) am Mittwoch mitteilte.
Gewalttätige Angriffe, wie zuletzt in Solingen, bei dem drei Menschen ihr Leben durch Messerstiche verloren, hinterlassen auch Spuren bei Menschen, die dabei nicht körperlich verletzt werden. Traumata sind häufig die Folge. So erging es auch Paula Ritter*, nachdem sie Ende Juni nach einer Messerattacke in Berlin-Kreuzberg Ersthelferin gewesen war.
Damals wurde ein 26-Jähriger mutmaßlich aus einer Menschengruppe heraus mit einem Messer attackiert. Infolge seiner schweren Verletzung verstarb er noch am Tatort. t-online hat mit Paula Ritter über ihre Erfahrungen und die damit verbundenen Folgen sprechen können.
Redaktioneller Hinweis
Dieser Text beschreibt in Teilen Szenen, die für manche Menschen belastend sein könnten.
t-online: Frau Ritter, was passierte 22. Juni am Kottbusser Tor?
Paula Ritter: Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere. Doch als ich aus der U-Bahn stieg, sah ich einen Mann am Boden liegen, um den sich eine Menschentraube gebildet hatte. Keiner der Umstehenden half dem Mann. Einer der Umstehenden setzte gerade einen Notruf ab, ich hörte, wie er davon sprach, dass der Liegende zuvor mit einem Messer attackiert worden war. Ich kniete mich zu dem Verletzten und versuchte, ihn zu versorgen. Später kam eine junge Frau dazu, die mich unterstützte.
Sie haben dann die Stichwunde versorgt?
Ich habe zuerst Atmung und Puls kontrolliert – seinen Kopf gestützt. Dadurch, dass ich von dem Messerangriff wusste, hatte ich immer im Hinterkopf: 'Die Wunde abdrücken, ich muss die Blutung stoppen.' Doch da war fast kein Blut. Erst als die Polizei später dazukam und wir den Mann entkleideten, fanden wir die Wunde – ein glatter Stich mitten in der Brust, direkt in die Lunge. Ohne die Hilfe des Beamten hätten wir es auch gar nicht geschafft, dem Mann das T-Shirt auszuziehen. Beim Anblick der Wunde wurde allen klar – die Lage ist mehr als ernst.
Wann haben Sie erfahren, dass der Mann es nicht geschafft hat?
Erst viel später. Bis die Sanitäter vor Ort waren, konnten wir noch seinen Puls fühlen. Im Nachhinein wurde mir klar, dass er starb, als er auf meinem Schoß lag.
Was macht Sie da so sicher?
Als er auf meinem Schoß lag, machte er drei oder vier tiefe Atemzüge – seine letzten. Danach atmete er nicht mehr, sein Puls war ganz schwach – aber noch zu spüren.
Klingt nach einer schrecklichen Erfahrung. Was macht eine solche Situation mit einem?
Es wirft einen aus dem Leben. Die erste Nacht war so schlimm für mich, dass ich zu einer Station für psychische Krisen gegangen bin – dort war ich dann insgesamt eineinhalb Wochen, stationär. Die Betreuung hat mir sehr geholfen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst geschafft hätte.
Womit hatten Sie konkret zu kämpfen?
Am Anfang, direkt nach der Situation, dachte ich noch: 'Das ist eben jetzt so, ich bin ja nicht der, der gestorben ist, also alles gut'. Abends fing dann das Gedankenkarussell an. Die Vorwürfe, die man sich selbst macht, fressen einen schier auf. 'Hätte ich doch etwas machen können, um seinen Tod zu verhindern?' Heute weiß ich, dass ich nichts hätte tun können. Und der Fakt, dass jemand in meinen Armen gestorben ist, muss auch erst mal verarbeitet werden.
Wie meinen Sie das?
Ich hatte immer wieder lange Flashbacks von der Situation. Also ich habe die Szene seiner letzten Atemzüge immer wieder vor mir gesehen – war wieder in der Situation. Das in Kombination mit den Vorwürfen, die man sich selbst macht, wird zu einem richtigen Gedankenstrudel, der einen immer tiefer zieht. Man kann buchstäblich nichts mehr, alles dreht sich nur noch darum. An Konzentration ist nicht mehr zu denken. Deshalb bin ich auch in die Klinik gegangen. Ich konnte mich zu diesem Zeitpunkt weder um mich noch um mein Kind kümmern.
Hatten Sie abseits der Klinik noch Hilfe?
Direkt nach der Situation war ich mit einer engen Freundin verabredet, sie blieb bis abends bei mir und ging mit mir zu den Befragungen bei der Polizei und den Notfallseelsorgern – das hat mir sehr geholfen.
Es waren also direkt vor Ort bereits Menschen, die Unterstützung angeboten haben?
Nein, die kamen erst viel später auf der Polizeiwache und selbst das dauerte Stunden, bis überhaupt angeboten wurde, ein Kriseninterventionsteam hinzuziehen. Wirklich geholfen hat mir diese Betreuung nicht – kein Vergleich zur Klinik. Generell wurde mir in und nach der Situation eigentlich nicht geholfen.
Können Sie das ausführen?
Als die Rettungskräfte eintrafen, wurden wir einfach weggeschickt. Auf der einen Seite verständlich, damit die Sanitäter arbeiten können. Aber dann stand ich mit blutverschmierten Händen mitten am "Kotti" – einfach allein gelassen, nur die andere Ersthelferin war bei mir. Zum Abwischen hatte keiner der Sanitäter oder Polizisten etwas, meine Daten hat auch niemand aufgenommen und ob die andere Helferin und ich vielleicht Hilfe bräuchten, interessierte offenbar auch niemanden.
Aber Sie sagten zuvor, dass Sie auf der Polizeiwache waren.
Richtig, war ich auch. Aber nur weil wir, nachdem wir endlich einen Ort zum Händewaschen gefunden hatten, wieder zur U-Bahn-Station zurückkehrten – wir wollten wissen, wie es dem Verletzten geht. Dort wurden wir dann von der Polizei mit zur Wache genommen.
Meiden Sie heute den U-Bahnhof am Kottbusser Tor?
Anfangs konnte ich nicht dort hingehen. Zur Verarbeitung bin ich dann mit einer Therapeutin immer wieder dorthin gegangen. Es ist weiterhin nicht wie früher, aber ich kann dort wieder U-Bahn fahren. Der "Kotti" war für mich immer ein Ort, an dem ich mich sicher gefühlt habe und häufig umgestiegen bin. Das Wohlbefinden von früher kämpfe ich mir jetzt Stück für Stück zurück.
Für viele gilt das Kottbusser Tor als eher verrufen. Wie steht es um Ihr generelles Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum?
Ich habe schon mehrere negative Erfahrungen im öffentlichen Raum und bei Großveranstaltungen gemacht. Allerdings bin ich sehr gerne draußen, bei Veranstaltungen und auf Festivals – bisher hatten die negativen Erfahrungen das nie getrübt. Nach dem Angriff in Solingen und generell der ganzen Debatte um Messerangriffe erwische ich mich aber immer häufiger dabei, dass ich vor Veranstaltungen über meine Sicherheit nachdenke. Gerade Messer sind so klein und übersehbar, das macht Angst – auf Dauer werde ich diese aber nicht zulassen.
Haben Sie noch abschließende Worte?
Mir ist wichtig, nochmals zu erwähnen, dass es gute Anlaufstellen gibt, an die man sich wenden kann. Dabei ist es egal, was Menschen konkret erlebt haben oder ob andere Schlimmeres erlebt haben. Bei manchen hätte es wahrscheinlich schon gereicht, an der Situation vorbeizulaufen, um ein Trauma zu haben – und das ist vollkommen okay. Hilfe benötigen diese Menschen dann trotzdem.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ritter!
*Name geändert, Klarname ist der Redaktion bekannt
- Gespräch mit Paula Ritter