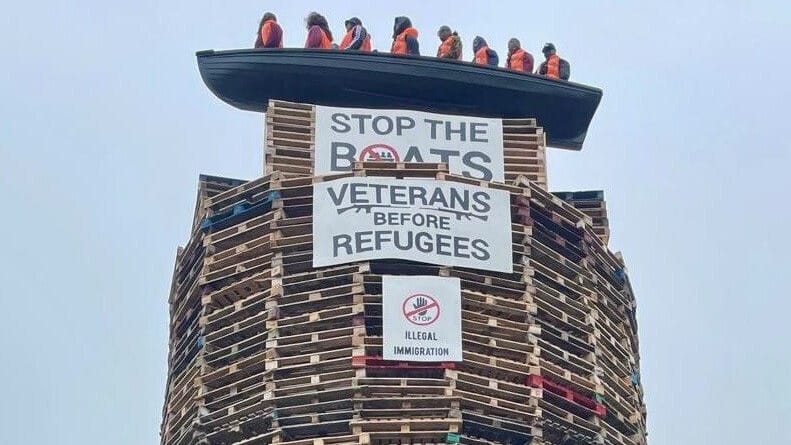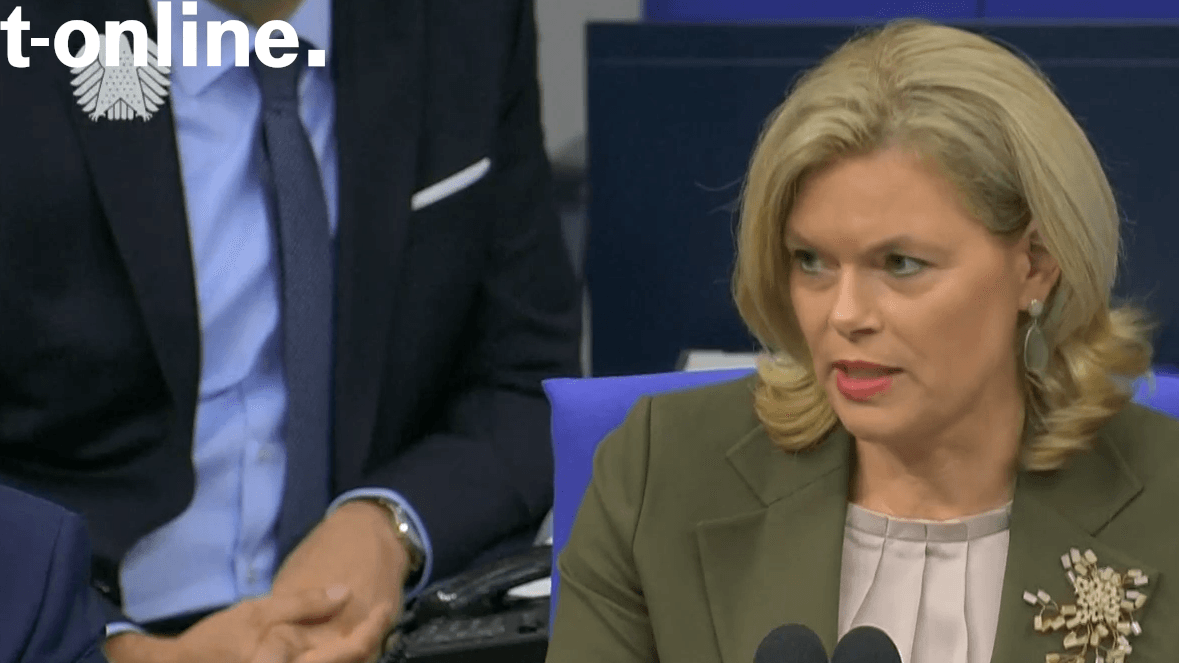Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Zweiter Weltkrieg Wie sich ein SS-Mörder an den Holocaust erinnerte


Deutschland ermordete Millionen Juden im Holocaust, bis heute erforschen Historiker diesen Zivilisationsbruch. Finden sich in Aussagen eines ranghohen SS-Mörders aus dem Jahr 1977 weitere Hinweise?
Freude herrschte im Oktober 1955 in der Bonner Republik, die Sowjetunion entließ ihre letzten deutschen Kriegsgefangenen – zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Als "Heimkehr der Zehntausend" feierte die westdeutsche Presse dieses Ereignis. Doch unter noch lebenden Vollstreckern des nationalsozialistischen Judenmords ging die Furcht um. Denn unter den Heimkehrern befand sich ein Mann namens Bruno Streckenbach.
Streckenbach, 1902 geboren, hatte im Nationalsozialismus Karriere gemacht, brachte es bis Kriegsende zum hochdekorierten SS-Gruppenführer und Befehlshaber einer Division der Waffen-SS. Vor seiner militärischen Laufbahn war Streckenbach allerdings zuletzt Personalchef im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) gewesen, einer Zentrale der nationalsozialistischen "Endlösung der Judenfrage", wie der Holocaust euphemistisch in Nazideutschland genannt wurde. Nach Kriegsende beriefen sich zahlreiche Kommandeure deutscher Mordeinheiten, die auf dem Gebiet der Sowjetunion agierten, in den Nürnberger Prozessen auf einen "Führerbefehl" zur Vernichtung der sowjetischen Juden: Bruno Streckenbach habe diesen im Auftrag von SS-Führer Heinrich Himmler und RSHA-Chef Reinhard Heydrich übermittelt, und zwar kurze Zeit vor dem deutschen Überfall vom 22. Juni 1941.
Befehlsnotstand hieß die Formel, mit der die Mörder die Schuld von sich schieben wollten: Wer nicht getötet hätte, wäre angeblich selbst bestraft worden. Befehl sei eben Befehl, selbst wenn dieser die Abschlachtung unzähliger Zivilisten anordnete. Für die Mörder war es eine "bequeme" Lösung, Streckenbach der Übermittlung des entsprechenden Befehls zu beschuldigen, war er doch nach Kriegsende für tot gehalten worden. Doch Streckenbach lebte, am 10. Mai 1945 war er in Kurland in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Auch diese überlebte der SS-Offizier und kehrte im Oktober 1955 nach Westdeutschland zurück.

Embed
Hören auf Spotify | Apple Podcasts || Transkript lesen
Überaus zweifelhaft, dass Streckenbach die bis dato kolportierte Version bestätigt hätte, denn das wäre für ihn selbst belastend gewesen. Die "bequeme" Lösung für die Kommandeure von Einsatz- und Sonderkommandos, die Juden in kaum vorstellbarer Zahl massakriert hatten, war entsprechend in Gefahr. Grundsätzlich drehte sich der Komplex um die Frage, ob und wann ein allgemeiner Befehl zur Ermordung der sowjetischen Juden – neben Männern auch Frauen und Kinder – ergangen war.
Schnell zur Staatsanwaltschaft
Streckenbachs Rückkehr gefährdete also die bisherige Darstellung. Zahlreiche Einsatzkommandoleiter "besannen" sich daher nun auf einen Vernichtungsbefehl aus dem August 1941, wie der Historiker Christian Gerlach in seinem Buch "Kalkulierte Morde" schreibt.
Nach der Heimkehr in seine Geburtsstadt Hamburg suchte Streckenbach von sich aus – begleitet von seinem Rechtsbeistand – die Staatsanwaltschaft in der Hansestadt auf. "Ob und was gegen ihn vorläge", wollte Streckenbach wissen, fasst es der Historiker Michael Wildt zusammen. Die Wahrscheinlichkeit für Ermittlungen gegen Streckenbach war gegeben, schließlich war er auch jahrelang Chef der Gestapo in Hamburg, die unzählige Verbrechen begangen hatte. Doch Streckenbach kam für diese Untaten davon, ganz zu schweigen von seiner damals wenig beachteten Rolle als Akteur des deutschen Vernichtungskriegs im Osten, wie Michael Wildt beklagt.
Heidemann-Sammlung im Internet
Die Hoover Institution Library & Archives in Kalifornien hat die umfangreiche Sammlung von Gerd Heidemann (1931 – 2024) erworben. Am 3. Mai 2025 stellte diese Institution den Inhalt von rund 800 Kassetten digitalisiert und transkribiert im Internet zur Verfügung. Darunter auch die Interviews, die Heidemann 1977 mit Bruno Streckenbach geführt hat. Interessierte finden das Material hier bei den Digital Collections der Hoover Institution Library & Archives. Thomas Weber von der Universität Aberdeen und Katharina Friedla als "Taube Family Kuratorin für europäische Sammlung" haben das Projekt verantwortet.
Jahrzehnte später sollte Streckenbach über seine Rolle als Teil des nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungsapparats doch noch sprechen – und zwar 1977 mit Gerd Heidemann. Heidemann war zu jener Zeit schillernder Starreporter des Magazins "Stern", der geradezu ein Faible für den Nationalsozialismus hegte. Mit Edda Göring, der Tochter der Nazi-Größe Hermann Göring, war Heidemann eine Zeit lang liiert, mit Karl Wolff, einem der engsten Mitarbeiter Heinrich Himmlers, war er befreundet. 1983 endete Heidemanns Karriere als Reporter nach einem Skandal um gefälschte Hitler-Tagebücher.
"Heidemann war ein Grenzgänger, der das, was die Nationalsozialisten angerichtet hatten, in keiner Weise guthieß", analysiert Historiker Thomas Weber, der den 2024 verstorbenen Heidemann persönlich kannte. Es war auch Thomas Weber, der die umfangreiche Sammlung Heidemanns – etwa 7.300 Ordner, fast 1.000 Audiokassetten und mehr als 100.000 Fotos – zum Nationalsozialismus und anderen Konflikten des 20. Jahrhunderts an die Hoover Institution an der Stanford University in Kalifornien vermittelt hat. Am 3. Mai 2025 wurde das Herzstück der Sammlung – etwa 800 Kassetten – digitalisiert und transkribiert der Öffentlichkeit im Internet erstmals zur Verfügung gestellt, t-online lagen Heidemanns Interviews mit Bruno Streckenbach vorab exklusiv vor.
Freundschaft unter Massenmördern
Darunter befinden sich auch zwei Gespräche vom Januar und Juli 1977. Ein Stimmvergleichsgutachten von 2023 kam zu dem Urteil, dass es sich beim Interviewten im Juli 1977 "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um Bruno Streckenbach handelt. Hierbei handelt es sich um die höchste Übereinstimmungsstufe, die zwischen Stimmproben eines todkranken, alten Sprechers und dem eines jüngeren, gesunden Sprechers bestehen kann. Das Gutachten war zum Schluss gekommen, dass es "keine Hinweise auf das Vorliegen unterschiedlicher Sprecher" gibt. Warum aber sind die Aussagen Streckenbachs für die historische Forschung von Bedeutung?
"Streckenbachs Aussagen sind deshalb so wichtig, weil Historiker oft argumentieren, dass Hitler nur allgemeine Reden gehalten habe", sagt Thomas Weber. "In diesen Reden habe der Diktator seine antisemitische Rhetorik verschärft, die dann von Entscheidungsträgern der zweiten und dritten Ebene als Inspiration und Ermutigung genommen wurde, um von der Verfolgung zur Vernichtung überzugehen." Weber hat eine andere Sicht: "Die Aussagen Streckenbachs legen vielmehr nahe, dass Hitlers Beteiligung an der Entwicklung der 'Endlösung' direkter war, als viele Wissenschaftler annehmen."
So schilderte Streckenbach dem Reporter Heidemann 1977 den früheren Besuch seines "alten Freundes" Erwin Schulz. Dieser war vormals Leiter der Gestapo in Bremen, Gewalt war ihm mehr als vertraut. Doch nun habe ihm Schulz – zu diesem Zeitpunkt Leiter des Einsatzkommandos 5 der Einsatzgruppe C, die sich durch die Ukraine mordete – zitternd "von Judenerschießungen" in der Sowjetunion berichtet.
Was tat Streckenbach laut eigener Aussage? "Ich bin zu Heydrich gegangen". Vom Chef des RSHA 1941 empfangen, soll daraufhin Folgendes geschehen sein: "Heydrich war ganz ruhig, ganz ernst, ganz sachlich", berichtete Streckenbach. Er beschied ihm: "Halten Sie den Mund. Stecken Sie sich nicht da rein. Wir können nichts machen. Das ist der Befehl des Führers."
Aufschlussreiche Einblicke?
Auch eine andere Gegebenheit, die Streckenbach im Kontext der Ermordung der sowjetischen Juden Heidemann berichtete, ist aufschlussreich. Dieses Mal erzählte er von einer Aussage Heinrich Himmlers in Bezug auf den Massenmord an den Juden: "Es ist ein Befehl des Führers, und ich werde immer, das müssten Sie eigentlich wissen, den Befehl des Führers erfüllen und wenn es noch so schwierig ist und wenn ich der letzte Mann bin, aber von mir hört der Führer kein 'Nein'".
Der hohe SS-Offizier Streckenbach kritisierte dabei weniger die Ermordung der Juden an sich, er erinnerte sich an seine eigene damalige Argumentation: "Erstens, wenn man so etwas macht, ist es eine Dummheit. Man muss es entweder konsequent machen. Alle 15 oder 16 Millionen Juden oder gar keinen, aber nicht ’nen paar Hunderttausend." Soweit Streckenbachs zynisches Kalkül.
Streckenbach zufolge wussten also Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich, der bis zu seinem Tod infolge eines Anschlags tschechoslowakischer Widerstandskämpfer im Juni 1942 einer der federführenden Organisatoren des Holocaust war, von einem Befehl Hitlers zur Vernichtung der sowjetischen Juden.
Heidemann hakte im Gespräch mit Streckenbach nach: "Weil da noch nie schriftlich was aufgetaucht ist bis heute, muss das ein mündlicher Befehl gewesen sein?" Streckenbachs Antwort: "Ja, kann doch nur." Streckenbachs Erinnerung ist also ein Indiz, kein Beweis für einen möglichen Befehl Hitlers zur Vernichtung der sowjetischen Juden.
Interview in den letzten Lebenswochen
Thomas Weber hält diese Aussage für "überaus interessant": "Streckenbach gibt Hinweise darauf, dass beides zu stimmen scheint: Einerseits haben die Angeklagten und ihre Verteidiger in den Einsatzgruppenprozessen apologetische Absprachen getroffen, andererseits scheint es zumindest einen mündlichen Befehl Hitlers hinsichtlich der Vernichtung der Juden gegeben zu haben."
Diesen Befehl habe aber nicht Bruno Streckenbach übermittelt. Er wies entsprechende Vorwürfe, die während seiner Gefangenschaft in der Sowjetunion im Nürnberger Einsatzgruppenprozess 1947/48 gefallen waren, entschieden zurück, wie es Michael Wildt in seinem Buch "Generation des Unbedingten" beschreibt. Einer der damaligen Verteidiger eines Angeklagten – Otto Ohlendorf, der die Einsatzgruppe D befehligt hatte und 1951 hingerichtet worden war – aus dem Einsatzgruppenprozess ist demnach Mitte der Fünfzigerjahre gar bei der Hamburger Staatsanwaltschaft vorstellig geworden und erklärte dort, dass die angebliche Überbringung eines "Führerbefehls" an die Einsatzgruppenleiter 1941 durch Streckenbach sei unwahr.
Stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Aussagen, die Bruno Streckenbach 1977 gegenüber Gerd Heidemann machte. Von Alter und schwindendem Erinnerungsvermögen abgesehen. Immerhin war Streckenbach Nationalsozialist durch und durch, er hatte etwa als Leiter einer Einsatzgruppe im deutsch besetzten Polen nach dem deutschen Überfall auf das Land schwerste Verbrechen zu verantworten.
Thomas Weber hält insbesondere die Aussagen zum "Führerbefehl" aus dem Interview vom Juli 1977 für belastbar: "Denn Streckenbach war zu diesem Zeitpunkt bereits todkrank." Sprich: Der frühere SS-Offizier hatte angesichts seines absehbaren Todes möglicherweise keinen Grund mehr, die Unwahrheit zu sagen.
Ferner wird allgemein anerkannt, dass Erwin Schulz im August 1941 nach Berlin zurückkehrte, um Bruno Streckenbach um seine Rückbeorderung aufgrund der eskalierenden Massenmorde gegen die jüdische Bevölkerung zu bitten. Schulz' Verhalten würde keinen Sinn ergeben, wenn Streckenbach schon zuvor einen allgemeinen Mordbefehl überbracht hätte. Außerdem wäre es die beste Schutzbehauptung für Streckenbach selbst gewesen, einfach in Abrede zu stellen, dass es Befehle von Hitler zur Judenermordung gegeben hat, die über die SS-Zentrale an die Ostfront gelangt sei.
Der Kranke sagte Heidemann damals zum Holocaust: "Das ist ja etwas, was jeden von uns interessiert. War Hitler der Initiator, hat er gewusst, hat er angeordnet. Ich persönlich muss Ihnen sagen: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mann neben oder unter Hitler diese Dinge von sich aus in die Wege geleitet hat.“ Nun war Bruno Streckenbach als Amtschef im RSHA kein Angehöriger des innersten Führungskreises des Nationalsozialismus, gleichwohl wusste der SS-Offizier mit besten Beziehungen zu Himmler und Heydrich sehr gut um die Dynamiken innerhalb des NS-Apparats.
Bedeutende Quelle?
Thomas Weber hält die von Gerd Heidemann geführten Interviews mit überlebenden NS-Tätern für außerordentlich wichtig für die historische Forschung: "Denn wir haben viel zu wenige Selbstzeugnisse dieser Leute, um ihre Motivation und ihr Handeln zu verstehen." Forschenden und Interessierten stehen Heidemanns Interviews und teilweise undercover geführten Gespräche mit NS-Tätern ab dem 3. Mai 2025 online zur Verfügung.
Der Historiker Michael Wildt schreibt: "Heute wissen wir aufgrund von neueren, intensiveren Forschungen, dass ein allgemeiner Mordbefehl den Einsatzgruppen im Juni 1941 nicht gegeben wurde, sondern die Erschießungen aufgrund von Himmlers persönlichen Inspektionen an die Ostfront im Sommer 1941 auch auf Frauen und Kinder ausgedehnt wurden." Bruno Streckenbachs Interviews mit Gerd Heidemann könnten daher möglicherweise einen Beitrag zur Erforschung von Genese und Ablauf des Holocaust bieten. In welchem Ausmaß, das wird künftige Forschung zeigen.
Bruno Streckenbach wurde für die von ihm begangenen Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland niemals gerichtlich belangt. Im Juni 1973 sollte zwar ein Hauptverfahren gegen ihn in Hamburg eröffnet werden, der Vorwurf lautete auf Ermordung von mindestens einer Million Menschen.
Seitens der Staatsanwaltschaft waren Zehntausende Seiten an Dokumenten und Dutzende Zeugenvernehmungen dafür vorbereitet worden, doch der Herzkranke ließ sich attestieren, verhandlungsunfähig zu sein. So kam Bruno Streckenbach davon. Er starb im Oktober 1977.
- Eigene Recherche
- Interviews von Gerd Heidemann mit Bruno Streckenbach 1977
- Statements von Thomas Weber
- Michael Wildt: "Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes", Hamburg 2002
- Michael Wildt: "Der Hamburger Gestapochef Bruno Streckenbach. Eine nationalsozialistische Karriere", in: Frank Bajohr & Joachim Szodrzynski (Hrsg.): Hamburg in der NS-Zeit. Ergebnisse neuerer Forschungen", Hamburg 1995
- Michael Wildt: "Die Ambivalenz des Volkes. Der Nationalsozialismus als Gesellschaftsgeschichte", Berlin 2019
- Christian Gerlach: "Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944", Hamburg 2000
- Annette Weinke: "Die Nürnberger Prozesse", 3., durchgesehene Auflage, München 2019
Quellen anzeigen