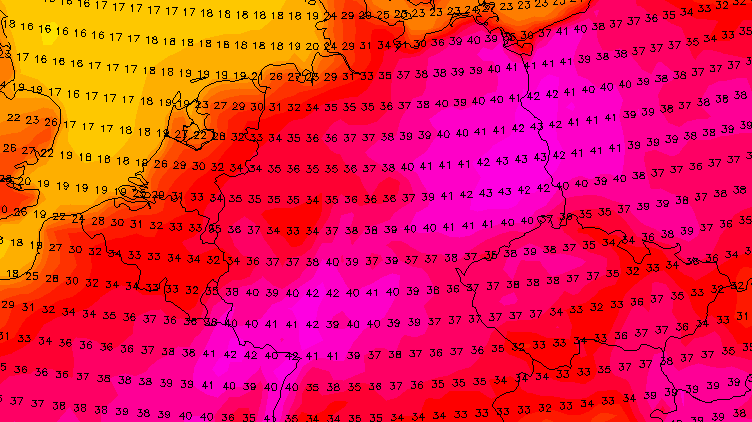Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Deutschlands Israel-Haltung Der Bruch ist längst da


Die neue deutsche Außenpolitik betont die unerschütterliche Verbundenheit zu Israel. Doch ein tiefgreifender Diskurs über das reale Verhältnis der beiden Länder bleibt komplex.
Vor seinem Antrittsbesuch in Israel bekräftigte der neue deutsche Außenminister: Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson. Er erklärte, dass man dieses "Bekenntnis […] auch heute neu interpretieren" solle. Man stehe "klar an der Seite Israels", was "kritische Diskussionen über die Politik der eigenen Regierung und befreundeter Nationen" nicht ausschließe.
Damit wiederholte Wadephul, was seine ehemalige Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 am Redepult der Knesset erklärt hatte. Die Kanzlerin sagte damals: "Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar." Heute wird das nur sinngemäß wiedergegeben: "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson." Das suggeriert Nähe. Doch sind Deutschland und Israel sich tatsächlich so nah?
Mit Blick auf Israel erkennt die Judaistin und Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, Tamara Or, 2019 in einem Interview mit der Zeitschrift "Osteuropa" eine Art "X-Syndrom": "Lange Zeit haben sich Deutschland und Israel aus unterschiedlichen Beweggründen aufeinander zu entwickelt. Doch die gegenläufigen Trends werden immer stärker."
Das bestätigt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Während 60 Prozent der Israelis ein "gutes" oder "sehr gutes Bild" von der Bundesrepublik haben, scheinen immer weniger Deutsche diese Sympathie zu erwidern. 2025 sind es nur noch 36 Prozent, dabei lag die Zahl 2021 noch bei 46 Prozent der Befragten.
Zu den Autoren
Monty Ott ist Autor, Politik- und Religionswissenschaftler. Er hat in Hannover studiert. Ott beschäftigt sich in seinen Schriften häufig mit Themen wie jüdischer Identität, Geschichte und Erinnerungskultur.
Ruben Gerczikow ist Autor und hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Anfang 2023 ist sein gemeinsam mit Monty Ott verfasster Reportage-Band "Wir lassen uns nicht unterkriegen – Junge jüdische Politik in Deutschland" im Verlag Hentrich & Hentrich erschienen.
Das Verhältnis, so Or, ist ex negativo konstituiert, aus dem industriellen Massenmord der Shoah heraus. Das "besonders" erinnert daran, wie spannungsreich diese Beziehung ist. Und es lässt uns die Frage danach stellen, was sich denn eigentlich hinter der vielbeschworenen Staatsräson aus deutscher Sicht verbirgt. Weite Teile des Parteienspektrums im Berliner Regierungsviertel beziehen sich positiv darauf.
Viele Politiker sind daran gescheitert
Das aber kann nicht davon ablenken, dass diese Staatsräson keinen gesamtgesellschaftlichen Unterbau hat. Laut Or ist das X-Syndrom, also das Auseinanderlaufen beider Gesellschaften, keine Zwangsläufigkeit und die Beziehungen könnten jederzeit zukunftsfähiger gestaltet werden. So interveniert sie: "Das setzt aber voraus, ehrlich zu sein und klar auszusprechen, dass Deutschland und Israel nicht nur und auch nicht in erster Linie durch die Shoah und die historische Verantwortung Deutschlands miteinander verbunden sind."
Die Shoah bilde keinen "ausreichenden Rahmen" für zukunftsfähige Beziehungen, auch wenn sie immer zum deutsch-israelischen Verhältnis dazugehöre. Or deutet also auf ein Mehr hin, das die Beziehung eigentlich ausmachen könnte.
Doch nicht nur Merkel, sondern auch viele Politikerinnen und Politiker nach ihr sind an der Herausforderung gescheitert, dieses Mehr zu erklären. Die Staatsräson und damit die Beziehung zwischen beiden Ländern sollte nicht nur ex negativo erklärt, sondern es muss eine echte Vision für sie entwickelt werden. Merkel blieb, wie viele andere Deutsche, im Abstrakten.
Die Beschäftigung mit der Frage, was denn eigentlich Staatsräson ist, wenn nicht nur die Übernahme historischer Verantwortung, verschlägt uns unmittelbar in die Gegenwart. Eine Gegenwart, in der das Ringen um die Konsequenzen der "Staatsräson" hierzulande immer wieder zu erbitterten Auseinandersetzungen führt.
Einerseits erschöpft sich die Staatsräson in der militärischen und diplomatischen Unterstützung Israels. Andererseits drehen sich Debatten hierzulande zunehmend um die Frage: "Wie unterscheidet sich israelbezogener Antisemitismus von Kritik an israelischer Politik?"
Beim Parteitag der Linken zeigt es sich besonders paradox
Immer wieder wird in den Konflikten um diesen Komplex die Behauptung erhoben, dass Staatsräson und historische Verantwortung dazu führen, dass die israelische Regierung die Definitionsmacht über Antisemitismus ergriffen habe, um kritische Stimmen mundtot zu machen. Dabei wird, vielleicht auch aufgrund der "besonderen Beziehung", über kaum ein anderes Land so öffentlichkeitswirksam debattiert wie über Israel.
Besonders paradox zeigte sich das auf dem Parteitag der Linken in Chemnitz. Nachdem man einen nur leicht entschärften, doch immer noch sehr hart formulierten Antrag zur israelischen Kriegsführung verabschiedet hatte, beschloss man einen weiteren Antrag, der die Unmöglichkeit von Kritik an der israelischen Politik und Kriegsführung beklagte.
Das muss anders gehen. Wenn es darum geht, über die Staatsräson zu sprechen, dann ist unser Ansatz ein emanzipatorischer. Das bedeutet, dass die existenzielle Bedrohung des Antisemitismus die Notwendigkeit ist, für einen jüdischen Schutzraum und jüdische Selbstbestimmung zu kämpfen. Dieser ist historisch und gegenwärtig der Staat Israel. Eine emanzipatorische Antwort ist aber auch, diesen aus Deutschland heraus nicht nur gegen die Bedrohung von außen, sondern auch von innen zu verteidigen.
Die gesellschaftlichen und politischen Krisen der vergangenen Jahre sind mit fortlaufender Dauer des Krieges auch nicht verschwunden. Die größte Bedrohung von Außen ist gegenwärtig das iranische Atomprogramm und dessen "Achse des Widerstands". Die größte Bedrohung von innen ist die extreme Rechte und die zunehmend wachsende ultraorthodoxe Gemeinschaft von Charedim, die den Staat Israel und seine Institutionen wie die Armee ablehnen. Israel ist ein demokratischer und jüdischer Staat.
Die extreme Rechte und die antizionistischen Charedim sind durch ihren Kampf gegen den demokratischen Teil Israels verbunden. Damit steht das kleine Land am Mittelmeer vor der gleichen Herausforderung wie viele demokratische Staaten des Globalen Nordens auch, in denen die extreme Rechte – oft im Bündnis mit religiösen Gruppierungen – gegen die liberale, demokratische Grundordnung kämpft.
Daher sollten auch die Erwartungen an diesen demokratischen Staat, wenn es beispielsweise zur Missachtung des Völkerrechts kommt, eine andere sein als an seine autokratischen Nachbarländer oder an die Terrororganisationen in der Region. Einen demokratischen Rechtsstaat muss man eben genau an diesen Prinzipien messen. Hier kann es keinen anderen Umgang geben als den, den man auch mit anderen europäischen und transatlantischen Partnern pflegt.
Die Hoffnungen auf ein friedliches Koexistieren sind gering
Dass der Krieg gegen die Hamas gerechtfertigt ist, steht nach dem Terror des "Schwarzen Schabbat" außer Frage. Aber ist deshalb jede Kriegsmaßnahme mit Blick auf die palästinensische Zivilbevölkerung recht und billig? Zu oft wird gesagt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung vor allem von palästinensischer Seite abgelehnt werde. Zur Wahrheit gehört auch, dass viele Israelis sie ebenfalls nicht wollen.
Die Hoffnungen auf ein friedliches Koexistieren sind inzwischen gering. Dennoch erleben wir statt komplexer Debatten zunehmend diese "Fußball"-Mentalität. Als könnte man ohne Rücksicht auf Verluste nur das eigene "Team" anfeuern. Aber so einfach ist das alles nicht. Es ist kompliziert. Und es wird noch komplizierter.
Wird sich das irgendwann in deutschen Debatten widerspiegeln? Leider ist oft auch kritische Distanz zu den "Freundinnen und Freunden" Israels angebracht. Tummeln sich doch hier viel zu oft Menschen, die einen Krieg in Gaza allein deshalb begrüßen, weil er sich angeblich gegen "den Islam" richte – wie die Antisemitismuskonferenz des "Diaspora"-Ministers Amichai Chikli eindrucksvoll veranschaulichte. Das kritikfreie Jubeln geht nicht selten auch mit rassistischen Ressentiments gegenüber muslimischen Communitys einher. Es muss zum Kern des deutsch-israelischen Verhältnisses werden, sich in der liberalen Demokratie und dem Bekenntnis zu universellen Menschenrechten verbunden zu fühlen.
Die Staatsräson darf kein leeres Instrument dafür sein, dass Deutschland die eigene "Wiedergutwerdung" (Eike Geisel) bejubelt. Sie muss mit konkreten Werten gefüllt werden. Und wer zu der antidemokratischen Bedrohung in Israel Stellung nimmt, darf zu der Bedrohung in Deutschland nicht schweigen. Der Kampf gegen jeden Antisemitismus ist nicht notwendig, weil eine Staatsräson oder die historische Verantwortung es verlangen, sondern weil der Antisemitismus die jüdischen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, Mitglieder dieser Gesellschaft bedroht.
Die Bekämpfung von Antisemitismus ist deshalb notwendig, weil dieser immer ein zutiefst antidemokratisches Phänomen ist. Antisemitismus – in jeder Ausdrucksform – zu bekämpfen ist nicht Ausdruck der "besonderen Freundschaft", sondern Kernaufgabe des demokratischen Rechtsstaates, der sich nicht in voreiligem Aktionismus verliert.
Die in Gastbeiträgen geäußerten Ansichten geben die Meinungen der Autoren wieder und entsprechen nicht notwendigerweise denen der t-online-Redaktion.