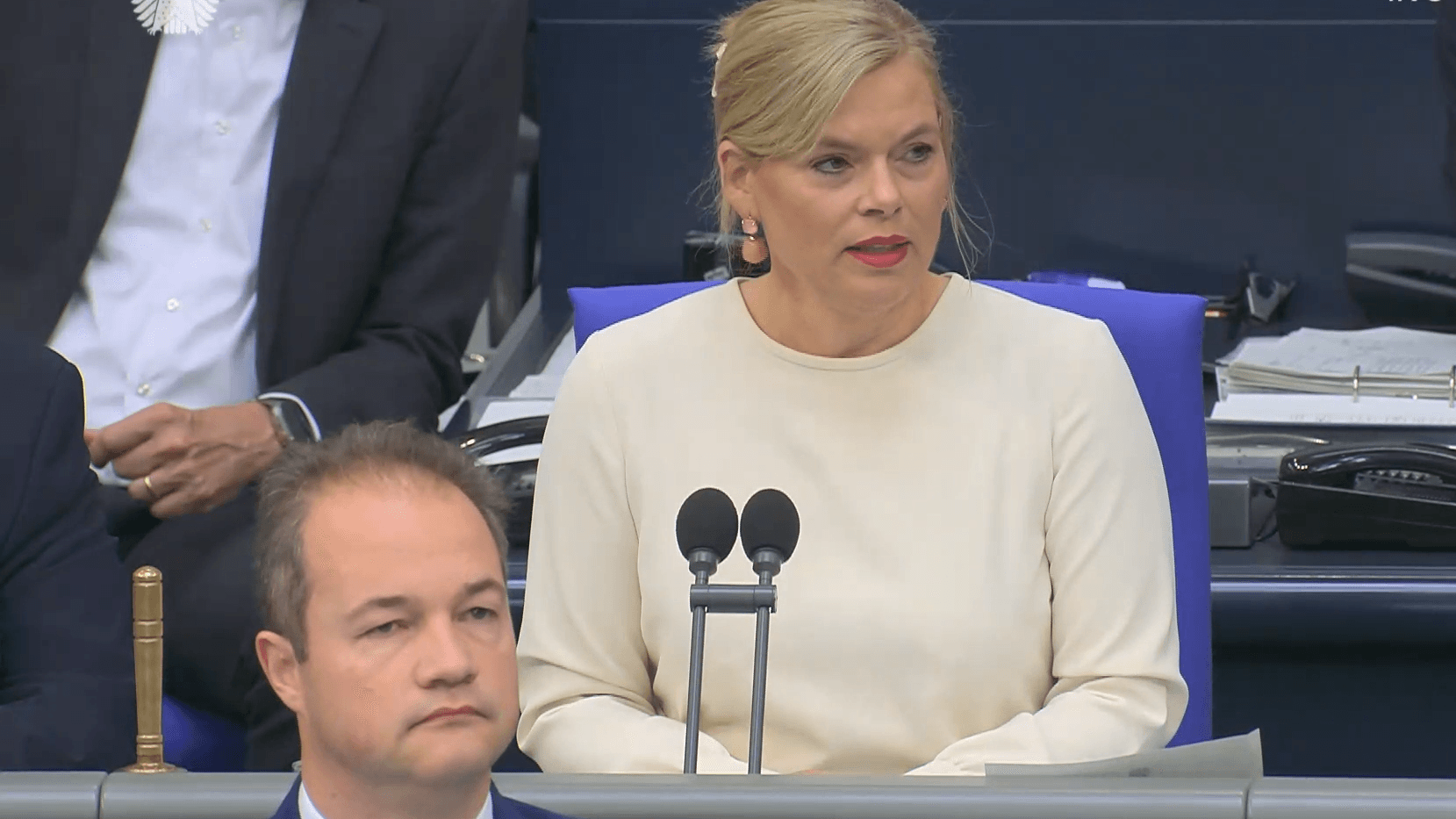Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Vizekanzler Scholz "Wir stecken in einem Dilemma"


Olaf Scholz ist einer der wichtigsten deutschen Corona-Krisenmanager. Im Interview spricht der Vizekanzler über das Dilemma einer Krise ohne Drehbuch – und widerspricht der Kanzlerin.
Olaf Scholz kommt immer dann ins Spiel, wenn es ums Geld geht. Und weil das Coronavirus Gesundheit und Wirtschaft zugleich bedroht, ist der Finanzminister und Vizekanzler gerade eine zentrale Figur der Krisenbewältigung in Deutschland und Europa.
Im Interview mit t-online.de spricht Scholz darüber, wieso er anders als Angela Merkel keine "Öffnungsdiskussionsorgien" sieht. Und der SPD-Politiker erklärt pünktlich zum EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, warum die Corona-Krise aus seiner Sicht dazu führen muss, dass die Europäische Union enger zusammenwächst.
Herr Minister Scholz, die Corona-Krise schränkt auch Ihren Alltag ein. Was vermissen Sie gerade am meisten?
Zugegebenermaßen vermisse ich den Frisör. Ansonsten geht es mir wie anderen auch. Mir fehlen die Dinge, die das Leben schön machen: das gesellige Zusammensein, der Restaurantbesuch mit meiner Frau, die Treffen mit den Freunden. Durch die Kontaktbeschränkungen sieht auch der öffentliche Raum viel leerer aus, als wir es gewohnt sind. Das ist aktuell natürlich angemessen, aber Stadtleben stelle ich mir anders vor.
Seit einigen Tagen sind wieder viel mehr Menschen draußen unterwegs. Haben Sie Sorge, dass viele nach der Lockerung der Kontaktsperre leichtsinnig werden?
Ich hoffe nicht. Die Bürgerinnen und Bürger gehen bisher unglaublich klug und gelassen mit der schwierigen Lage um. Alle haben verstanden, dass wir uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen, solange es keine wirksamen Medikamente und keinen Impfstoff gegen das Virus gibt. Das wird dauern. Auch wenn wir jetzt wieder Läden öffnen können und es in den Schulen so langsam wieder losgeht, wird unser Alltag ganz lange anders sein, als wir es gewohnt gewesen sind.
Also läuft der Vorwurf der Kanzlerin, es würden "Öffnungsdiskussionsorgien" geführt, ins Leere?
Natürlich wird über den richtigen Weg zu einer vorsichtigen Öffnung diskutiert. Die föderale Struktur ist eine Stärke unseres Landes. Wir haben nicht nur ein starkes Zentrum, sondern viele Zentren. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind gute Diskussionspartner für die Bundesregierung.
Sie widersprechen also der Kanzlerin.
Wir können doch ganz offen sagen, dass wir in einem Dilemma stecken. Oberstes Ziel bleibt es, dass die Infektionszahlen unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Deshalb darf sich das Virus nicht zu schnell ausbreiten. Zugleich müssen wir das soziale und wirtschaftliche Leben allmählich wieder in Gang bringen. Dafür braucht es sorgfältig erörterte Schritte – wir müssen dabei aber immer die Infektionszahlen im Blick behalten. Wir sind längst nicht über den Berg.
Die Kanzlerin hat mit ihrer Äußerung wohl auch darauf angespielt, dass durch die Lockerungen nun bundesweit ein Flickenteppich entstanden ist, weil jedes Bundesland die Regeln anders auslegt. Warum hat es die Bundesregierung nicht geschafft, das besser zu koordinieren?
Ich widerspreche: Die Lockerungen sind gut koordiniert und es gibt keinen Flickenteppich.
Wie bitte? Sie können doch nicht abstreiten, dass es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern gibt.
Natürlich gibt es unterschiedliche Regeln an der ein oder anderen Stelle, das hat auch damit zu tun, dass es regional unterschiedliche Betroffenheiten gibt – diese Unterschiede sind aber überhaupt kein Problem. Auf die Grundlinien des Weges haben wir uns gemeinsam klar verständigt. Ich erlebe das als eine Phase sehr großer Einigkeit. Wir sollten nicht das Haar in der Suppe suchen.
In Nordrhein-Westfalen öffnen Möbelhäuser, in Bayern nicht. Solche Unterschiede lassen sich doch nicht objektiv mit wissenschaftlichen Erkenntnissen erklären.
Ich würde diese Unterschiede nicht überzeichnen. Wir nehmen die Erkenntnisse der Epidemiologen und Virologen sehr ernst. Unsere Aufgabe als demokratisch gewählte Politiker ist es, sie aufzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Diese Verantwortung kann uns keiner abnehmen.
Dann verstehen wir das also so, dass in dieser völlig neuen Situation auch die Ministerpräsidenten erst einmal nach der besten Lösung suchen müssen?
Die Länder sind unterschiedlich stark vom Virus betroffen, deshalb können unterschiedliche Regeln sinnvoll sein. Aber alle wissen auch: Es gibt keine letzten Wahrheiten, und wir müssen trotzdem die Entscheidungen treffen. Und das funktioniert ganz gut.
Die Lockerungen führen sehr wahrscheinlich zu mehr Infektionen. Fürchten Sie eine zweite Welle der Epidemie?
Wir müssen vorsichtig bleiben. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, schrittweise vorzugehen. Dabei werden wir immer wieder berücksichtigen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.
Jetzt Lockerungen, womöglich dann aber wieder ein Shutdown: Davor hat die Kanzlerin gewarnt. Wie hart würde so ein zweiter Shutdown die Wirtschaft treffen?
Das wäre nicht gut. Deshalb versuchen wir ja, genau das zu vermeiden.
Und Sie sind optimistisch, dass das gelingt?
Ich bin zuversichtlich. Wir haben uns die Entscheidungen nicht leicht gemacht und gut durchdacht.
Und es ist ziemlich teuer. Der Bundestag hat 156 Milliarden Euro neuen Schulden zugestimmt. Reicht das, um Deutschland durch diese Krise zu bringen?
Ob es reicht, kann aktuell niemand wirklich wissen. Aber es ist ein sehr großer und weitreichender Schritt gleich zu Beginn gewesen. Wir haben die "Bazooka" rausgeholt, das habe ich damals bewusst so gesagt. Es war eine mutige und klare Botschaft an Unternehmen, Beschäftigte und Öffentlichkeit. Das hat funktioniert, wir haben uns einen großen Spielraum geschaffen. Und über den Haushalt für nächstes Jahr werden wir bewusst erst im Herbst diskutieren, um die weiteren Entwicklungen berücksichtigen zu können.
Es gibt also noch Spielraum, etwa für den Fall einer zweiten Infektionswelle?
Wir haben einigen Spielraum, weil wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben. Unsere Verschuldung lag zu Beginn der Krise unter 60 Prozent, also im Einklang mit den Maastricht-Kriterien der EU. Nach der Finanzkrise hatte sie noch mehr als 80 Prozent betragen. Jetzt bewegen wir uns gerade in Richtung 75 Prozent.
- Newsblog: Alle aktuellen Infos im Überblick
- Coronavirus: Symptome, Übertragung und Ursprung der Krankheit
- Covid-19 in Deutschland: An diesen Orten gibt es Infektionen
Sie sprechen immer wieder von einer "neuen Normalität", in die wir jetzt übergehen müssten. Was genau meinen Sie damit?
Ich möchte damit deutlich machen, dass wir uns an ein Leben mit dem Coronavirus für eine längere Zeit gewöhnen werden und unseren Alltag darauf ausrichten müssen. Wir haben es mit einer Naturkatastrophe zu tun, die über die Menschheit gekommen ist. Mit massiven Beschränkungen ist es gelungen, das Infektionsgeschehen soweit zu verlangsamen, dass unser Gesundheitssystem damit zurechtkommen kann. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt und jede Lockerung wird sich auswirken. Bis es einen Impfstoff gibt, müssen wir gewisse Regeln einhalten – Abstand halten, Hände waschen, weniger soziale Kontakte. Und in dieser Zeit müssen wir solidarisch sein: in Deutschland, in Europa und in der Welt.
Haben Sie den Eindruck, dass die Bevölkerung die Schutzmaßnahmen über Monate durchhalten kann?
Ja, die Erfahrungen der vergangenen Wochen stimmen mich optimistisch. Wichtig ist, dass wir als Politiker unsere Entscheidungen transparent erklären, damit sie nachvollziehbar sind.
Muss das Kurzarbeitergeld steigen, damit die Menschen die Krise durchstehen können?
Schon in der Finanzkrise 2008/2009, als ich als Bundesarbeitsminister das Kurzarbeitergeld eingeführt habe, haben viele Unternehmen das Kurzarbeitergeld aufgestockt. Einige tun das jetzt wieder. In der aktuellen Krise sind aber viel mehr Beschäftigte betroffen, auch in Betrieben, in denen leider nur sehr geringe Gehälter gezahlt werden. Deshalb sprechen wir darüber, ob der Staat für eine bestimmte Zeit noch stärker unterstützen kann.
Spanien und Italien bitten eindringlich um mehr Hilfe, der italienische Ministerpräsident Conte hat in deutschen Medien an die deutsche Bevölkerung appelliert. Tut die EU genug, um die besonders hart getroffenen Staaten zu unterstützen?
Ich bin sehr froh, dass wir es – anders als seinerzeit in der Schuldenkrise – hinbekommen haben, sehr schnell ein 500-Milliarden-Euro-Paket für Europa auf den Weg zu bringen. Wir unterstützen damit kleine und mittlere Unternehmen durch die Europäische Investitionsbank, so wie es die KfW in Deutschland macht. Es gibt ein Programm zur Finanzierung von Kurzarbeit und einen Zugang zum Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, um die Finanzierung der Staaten sicherzustellen. Zusammen mit den Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank sind das starke, solidarische Antworten. Für die Zeit nach der Krise haben wir einen "Recovery Fund" beschlossen, damit die Wirtschaft überall wieder anspringt. Wir wollen, dass alle Staaten auch nach der Krise gut dastehen.
Italien verlangt aber mehr: Corona-Bonds, also eine gemeinsame Schuldenhaftung. Darum wird es auch beim EU-Gipfel am Donnerstag gehen. Die bisherigen Hilfspakete sehen das nicht vor, vor allem die Niederlande und Deutschland verhindern sie. Warum wehren Sie sich so vehement dagegen?
Schon mit dem 500-Milliarden-Euro-Paket tun wir deutlich mehr als in der Schuldenkrise. Das ist mir wichtig. Und jetzt müssen wir in Europa gemeinsam besprechen, was wir zusätzlich noch brauchen und wann wir es brauchen. Die Staats- und Regierungschefs müssen einen Fahrplan vereinbaren, wie die Konjunktur nach der Phase des Lockdowns unterstützt werden soll. Nur eines ist klar: Wenn wir weiter zusammen und solidarisch handeln wollen wie mit dem "Recovery Fund", der ja nochmal eine ähnliche Größenordnung haben wird, dann braucht es auch weitere Integrationsschritte in der EU.
Wie muss die EU konkret weiter zusammenwachsen?
Ein Schritt ist es, den bereits erwähnten Stabilitätsmechanismus, den ESM, weiterzuentwickeln, da sind wir schon sehr weit gekommen. Es braucht die Europäische Bankenunion, also einheitliche und gemeinsame Regeln für Banken in der EU – dafür habe ich vor einiger Zeit schon Vorschläge gemacht. Und wir müssen bei der Kapitalmarktunion vorankommen, um grenzüberschreitend besser zusammenzuarbeiten. Und es geht darum, wie wir die EU finanzieren. Die EU braucht dann auch gemeinsame Einnahmen. Es wäre zum Beispiel hilfreich, wenn sich viele Staaten an der Besteuerung von Finanztransaktionen beteiligen. Vielleicht können sich darauf sogar alle einigen und das kann dann eine Finanzquelle werden.
Corona-Bonds haben Sie jetzt nicht genannt. Schließen Sie aus, sie etwa zur Finanzierung des "Recovery Fund" zu nutzen?
Diskussionen sollten nicht um Instrumente geführt werden, sondern darüber, ein Problem zu lösen. Das Problem ist: Es gibt Staaten, die für den Wiederaufbau viel Geld benötigen. Das müssen wir solidarisch hinbekommen. Erst einmal müssen wir aber schauen, wie viel Geld konkret benötigt wird und wofür es eingesetzt werden soll. Da muss jetzt erst einmal Butter bei die Fische, wie wir Hamburger sagen. Und dann diskutieren wir über die Finanzierung. Das geschieht am sinnvollsten in der Debatte um den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen, den EU-Haushalt.
Damit die EU zusammenwachsen kann und eine Fiskalunion funktionieren kann, wird es doch aber auch in Steuerfragen Änderungen geben müssen, oder?
Ja. Eine Fiskalunion hätte steuerliche Grundstandards, denn man kann bei stärkerer fiskalischer Integration nicht zulassen, dass Unternehmen in den Staaten zu unterschiedlich besteuert werden. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung bei Körperschaften. Und wir werden noch viele andere steuerliche Praktiken zusammenführen müssen. Das ist die Voraussetzung, wenn man solidarisch und gemeinsam handeln will.
Braucht es auch eine EU-Arbeitslosenrückversicherung, wie Sie sie im Jahr 2018 vorgeschlagen haben?
Eine Rückversicherung für die verschiedenen Arbeitslosenversicherungssysteme in den EU-Staaten wäre ein wichtiger Beitrag zur Solidarität, um auf Krisen reagieren zu können. In den USA, die ja schon lange eine Fiskalunion sind, funktioniert das längst mit gutem Erfolg.
Jenseits der finanziellen Debatte in der EU gibt es auch eine kulturelle Ebene: Politiker aus Südeuropa fühlen sich wieder einmal von Deutschland bevormundet. Können Sie das nachvollziehen?
Wenn wir zurückblicken, dann läuft die derzeitige Debatte weniger aufgeregt als früher. Dafür war es wichtig, dass sich die EU-Finanzminister unserem Vorschlag angeschlossen haben, die Hilfen für die Staaten diesmal ohne eine Troika zu vergeben, die in der Schuldenkrise Geld nur gegen einen umfangreichen Umbau der Staaten gewährt hatte.
In Deutschland managen Union und SPD diese Krise derzeit gemeinsam in der großen Koalition. Warum profitiert die SPD in den Umfragen viel weniger davon als die Union?
Es geht jetzt darum, die konkreten Probleme zu lösen und das Richtige zu tun. Dafür gibt es viele positive Rückmeldungen. Viele nehmen wahr, dass wir das ordentlich machen. Das freut mich natürlich.
Aber in den Umfragen kommt das für die SPD noch nicht so richtig an.
Darum geht es auch nicht zuvörderst. Aber wir sollten nicht besorgt fragen, ob die SPD jetzt nach vorne kommt. Das passiert gerade und ich bin sicher, dass da noch mehr drin ist.
Sie persönlich sind derzeit ähnlich beliebt wie Markus Söder oder Angela Merkel. Müsste die SPD Sie zum Kanzlerkandidaten machen, um Klarheit und Machtwillen zu signalisieren?
Das ist jetzt nicht die Zeit für Eitelkeiten. Wir haben von morgens bis nachts damit zu tun, Probleme zu lösen.
Wenn Sie also nach vorne blicken: Wie wird Deutschland in einem Jahr dastehen?
Ich hoffe, dass dann die schlimmsten Auswirkungen der Krise in ökonomischer und sozialer Hinsicht hinter uns liegen. Schön wäre es, wenn wir wirksame Medikamente und einen Impfstoff hätten. Und wenn möglichst wenige Menschen unter den Folgen der Krankheit zu leiden hätten. Und wenn unsere Gesellschaft durch diese Krise sozial etwas enger zusammenrücken würde, wäre mir das sehr recht.
Ist das die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg?
Ich glaube ja, auch wenn es schon viele Krisen gegeben hat. Diese Pandemie ist eine Krise ohne Drehbuch, wir können da nicht auf Erfahrungen zurückgreifen. Sie zeigt uns, wie verletzlich wir als Menschen sind. Und sie zeigt, dass nicht Eigennutz gefragt ist, sondern Solidarität.
Letzte Frage: Sie haben gesagt, dass Sie den Frisör vermissen. Haben Sie schon einen Termin?
Nein. Aber ich werde zum Frisör gehen, sobald es wieder möglich ist. Bis dahin werde ich meine Haare weiter selbst mit der Schneidemaschine bearbeiten – und mit dem Ergebnis leben müssen.
- Gespräch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz per Telefon