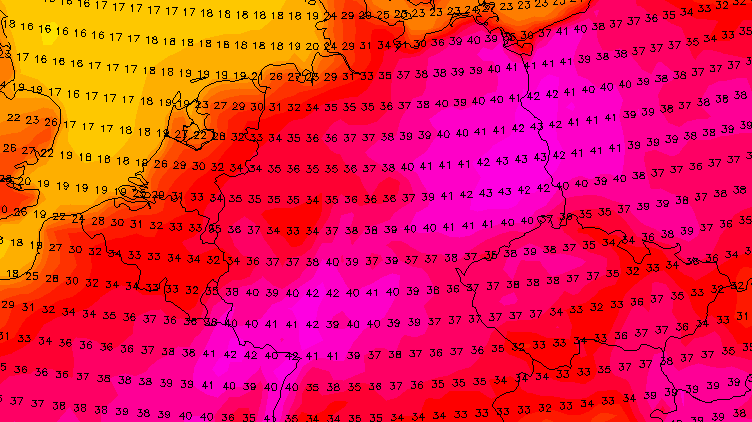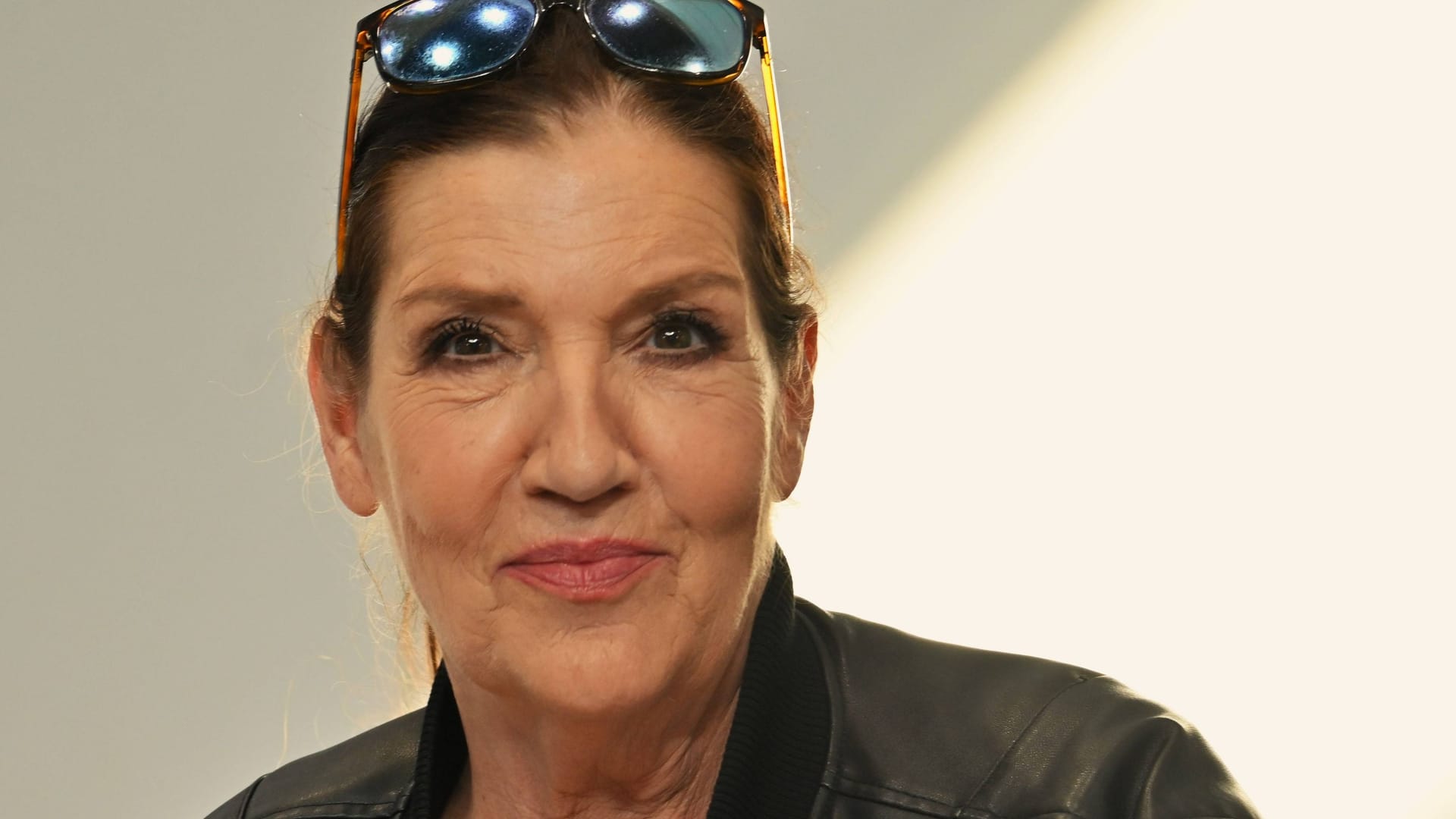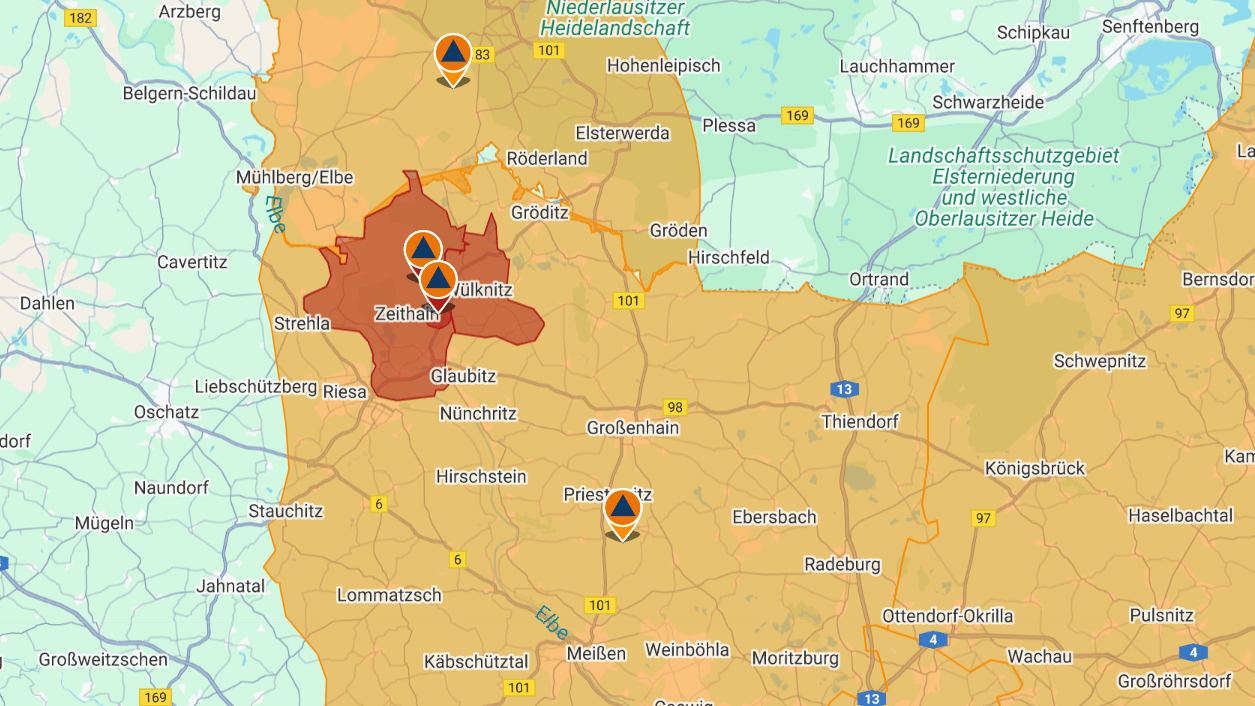Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Er führt einen Kreuzzug gegen Rom Petrus III. – der Schweizer Gegenpapst


Abgeschottet von der Welt, mit selbst geschriebener Bibel und eigener Heiligenschar: Die palmarianische Kirche ist eine der bizarrsten Abspaltungen der katholischen Welt.
Am Rand eines spanischen Dorfes steht eine Kathedrale für 100 Millionen Euro – gebaut nicht von der katholischen Kirche, sondern von einer kleinen, abgeschotteten Glaubensgemeinschaft mit eigenem Papst: der palmarianisch-katholischen Kirche. Ihr Oberhaupt nennt sich Petrus III., residiert in Palmar de Troya – und hält sich für das einzige legitime Oberhaupt der Weltkirche.
Alles begann im Frühling des Jahres 1968. Im kleinen andalusischen Dorf Palmar de Troya, rund 40 Kilometer südlich von Sevilla, behaupten vier Schulmädchen, ihnen sei die Jungfrau Maria erschienen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Pilger strömten in den Ort, berichteten von Lichtphänomenen, Heilungen und weiteren Erscheinungen. Die katholische Kirche blieb skeptisch – und erkannte das Geschehen nie offiziell an.
Ein Jahr später, 1969, trat ein Mann auf den Plan, der das kleine Dorf für immer verändern sollte: Clemente Domínguez y Gómez.
Gómez berichtet von Visionen und Stigmata
Er hatte einen schweren Start ins Leben: Homosexuell, von Mitschülern gemobbt, versuchte er sogar einmal, sich das Leben zu nehmen. Als er sich zum Priester berufen fühlte, wurde er abgelehnt – sowohl vom Priesterseminar als auch vom Dominikanerorden. Stattdessen wurde er Buchhalter.
Ab Sommer 1969 besuchte Gómez Palmar de Troya fast täglich. Irgendwann erzählte er, ihm seien Christus und Maria erschienen. In seinen Visionen wetterte die Muttergottes gegen die kirchlichen Reformen, prangerte Häresie und "Progressivismus" an. Einmal, so wird behauptet, habe Gómez bei einer Erscheinung 16 Liter Blut verloren – eine medizinische Unmöglichkeit, die von Ärzten nie bestätigt wurde.
Im selben Jahr nahm die Geschichte jedoch eine spektakuläre Wendung: Der ehemalige katholische Erzbischof von Huế in Vietnam, Pierre Martin Ngô Đình Thục, der selbst isoliert und umstritten war, reiste nach Spanien. Dort weihte er Gómez am 1. Januar 1976 zunächst zum Priester, nur zehn Tage später sogar zum Bischof. Eine Weihe, die ohne päpstliche Erlaubnis erfolgt war – und daher gegen das Kirchenrecht verstieß.
Angebliche himmlische Botschaften nach Erblindung
Gómez nannte sich aber fortan Bischof Primas Pater Clemente und begann seinerseits, Priester- und Bischofsweihen durchzuführen – weihte teilweise Minderjährige. Die palmarianische Bewegung formierte sich langsam zu einer eigenen Kirche.
1976 erlitt Pater Clemente einen schweren Autounfall, bei dem er beide Augen verlor. Doch an Rückzug dachte er nicht – im Gegenteil. Er behauptete, Maria habe ihm in einer weiteren Erscheinung den neuen Namen "Pater Fernando" verliehen.
Am 6. August 1978, dem Todestag von Papst Paul VI., erklärte Clemente schließlich, er habe erneut eine himmlische Botschaft empfangen. Diese verpflichte ihn, den vakanten Stuhl Petri selbst zu übernehmen. Seine sogenannten Kardinäle erhoben ihn daraufhin zum Papst Gregor XVII. – ein radikaler Bruch mit Rom.
Für die römisch-katholische Kirche ist die Lage klar. 1983 erklärte die Glaubenskongregation offiziell, dass die Weihen von Clemente ungültig seien. Der selbst erklärte Papst, seine Kardinäle und alle von ihm Geweihten wurden exkommuniziert – also aus der Kirche ausgeschlossen.
Der Gegenpapst schreibt Bibel um
Doch dies setzte der Bewegung kein Ende. Die palmarianisch-katholische Kirche ging in einen ideologischen Krieg mit dem Vatikan über. Sie bezeichnete die katholische Kirche in Rom fortan als "verfallen" und sich selbst als einzig wahre Kirche auf Erden.
Rund um das Jahr 2000 veröffentlichte die Gemeinschaft eine eigene Bibelübersetzung, die auf eine Überarbeitung durch Clemente zurückgeht. Inhaltlich ist sie stark verändert – angepasst an die Lehren der Palmarianer. Nicht Rom, sondern Palmar de Troya war der neue Mittelpunkt des wahren Katholizismus.
Clemente schrieb die Bibel um: Er änderte ganze Passagen, von denen er behauptete, Gott selbst habe sie als Lügen entlarvt. Es folgten Heiligsprechungen en masse: Fast jedes verstorbene Mitglied mit Funktion wurde heiliggesprochen – ebenso Christoph Kolumbus oder der faschistische Diktator Francisco Franco. Die Marienverehrung trieb Clemente auf die Spitze: Die Muttergottes nimmt in der palmarianisch-katholischen Kirche eine nahezu göttliche Rolle ein. In der Apokalypse, so die Lehre, soll es sogar eine "Antimaria" geben – als Gegenspielerin zum Antichristen.
Abschottung und Spenden
Seit den 1980er-Jahren begann die Kirche, sich zunehmend von der Außenwelt abzuschotten. Private Kontakte außerhalb der Gemeinschaft sind heute verboten. Gespräche müssen sich auf das Notwendigste beschränken. Besucher auf dem Gelände sind unerwünscht.
Trotzdem: Die Mitgliederzahl wuchs – und mit ihr der Reichtum. Finanziert durch hohe Mitgliedsbeiträge und Spenden entstand auf dem Gelände in Palmar eine prächtig ausgestattete Kathedrale, die bis 2014 fertiggestellt wurde. Kostenpunkt: rund 100 Millionen Euro.
Gegenpapst verliebt sich in Nonne
Ihre Fertigstellung erlebte der Gegen-Papst Gregor XVII. nicht mehr. Er starb 2005. Sein Nachfolger, Petrus II., erließ noch strengere Regeln und ließ die Schriften seines Vorgängers vernichten. 2011 folgte Gregor XVIII. – doch 2016 kam der Eklat: Am 22. April 2016 legte Gregor XVIII. sein Amt freiwillig nieder – weil er sich verliebt hatte. Er verließ die Kirche gemeinsam mit einer Nonne aus dem Orden, heiratete sie – und erklärte die ganze palmarianische Kirche für eine Täuschung. In Interviews sprach er später offen über Manipulation, Angst und Machtmissbrauch innerhalb der Sekte. Die allermeisten der anfangs etwa 10.000 Mitglieder verließen die Kirche – aber nicht alle.
Seit 2016 führt der Schweizer Joseph Odermatt als Petrus III. die palmarianische Kirche. In einer Predigt sprach er 2011 von nur noch 1.000 bis 1.500 verbliebenen Mitgliedern. Doch trotz des massiven Einbruchs existiert die Kirche weiter – abgeschottet, radikal und überzeugt davon, die einzig wahre zu sein.
"Sehr körperfeindliche Menschen"
Der österreichische Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger erklärt: "Diese Kirche hat nicht nur den Tod ihrer Gründungsfigur, sondern sogar den Austritt ihres eigenen Papstes überlebt." Schmidinger ist einer der wenigen Forscher, die je an einer Liturgie der Palmarianer teilnehmen durften. "Von ihren Werthaltungen sind die Palmarianer ultrakonservative, mit dem spanischen Franquismus sympathisierende, sehr körperfeindliche Menschen", fasste Schmidinger seine Beobachtungen zusammen. Dazu passen auch Berichte über Selbstverstümmelungen.
Religionswissenschaftlich ist die Bewegung ein Spiegel innerkirchlicher Spannungen. Der Theologe Magnus Lundberg erklärt: "Viele Menschen erkannten ihre Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr wieder und betrachteten die postkonziliaren Entwicklungen als Bruch mit der Vergangenheit."
Letzter sicherer Ort einer "reinen" Kirche
Auch Schmidinger sieht im Zweiten Vatikanischen Konzil einen Ursprung für die Entstehung zahlreicher radikaler Bewegungen: "Das Gros der traditionalistischen Gruppen arbeitet sich am Zweiten Vatikanischen Konzil ab und hat sich gewissermaßen wegen der Frage der 'Neuen Messe', aber auch den gesellschaftspolitischen Neupositionierungen in der katholischen Kirche wie der Akzeptanz der Menschenrechte, Versöhnung mit der Demokratie, Ökumene, interreligiöser Dialog vom Vatikan abgewandt", erklärt der Politikwissenschaftler.
Clemente griff diese Kritik auf – und formte daraus eine Kirche, in der die alten Werte wieder gelten: Keuschheit, Gehorsam, Abgrenzung. Seine Schriften sprechen von einer von Freimaurern und Kommunisten unterwanderten Amtskirche. Dass sich ausgerechnet Erzbischof Thục seinerzeit für einige Jahre mit der Bewegung verband, galt als Beweis der Legitimität – auch wenn dieser sich bald wieder von den Palmarianern distanzierte.
Was 1968 mit einer Marienerscheinung begann, entwickelte sich unter Clemente Domínguez zu einem radikalen Parallelkatholizismus mit eigenem Papst, eigener Liturgie, eigener Bibel – und einem rigorosen Lebensstil. Die palmarianische Kirche ist heute nicht mehr als eine kleine Splittergruppe. Aber sie steht symbolisch für eine tiefere, globale Dynamik: den Wunsch nach Eindeutigkeit in einer komplexen Welt. Für einige Gläubige bleibt Palmar de Troya der letzte sichere Ort einer "reinen" Kirche.
- katholisch.de: "Autor: Durch Austritte werden Traditionalisten einflussreicher"
- katholisch.de: "Mit eigenem Papst und Vatikan: Die palmarianisch-katholische Kirche"
- vice.com: "La secta que santificó a Franco" (Spanisch)
- youtube.com: "Der Heilige Ort der Erscheinungen von El Palmar"
Quellen anzeigen