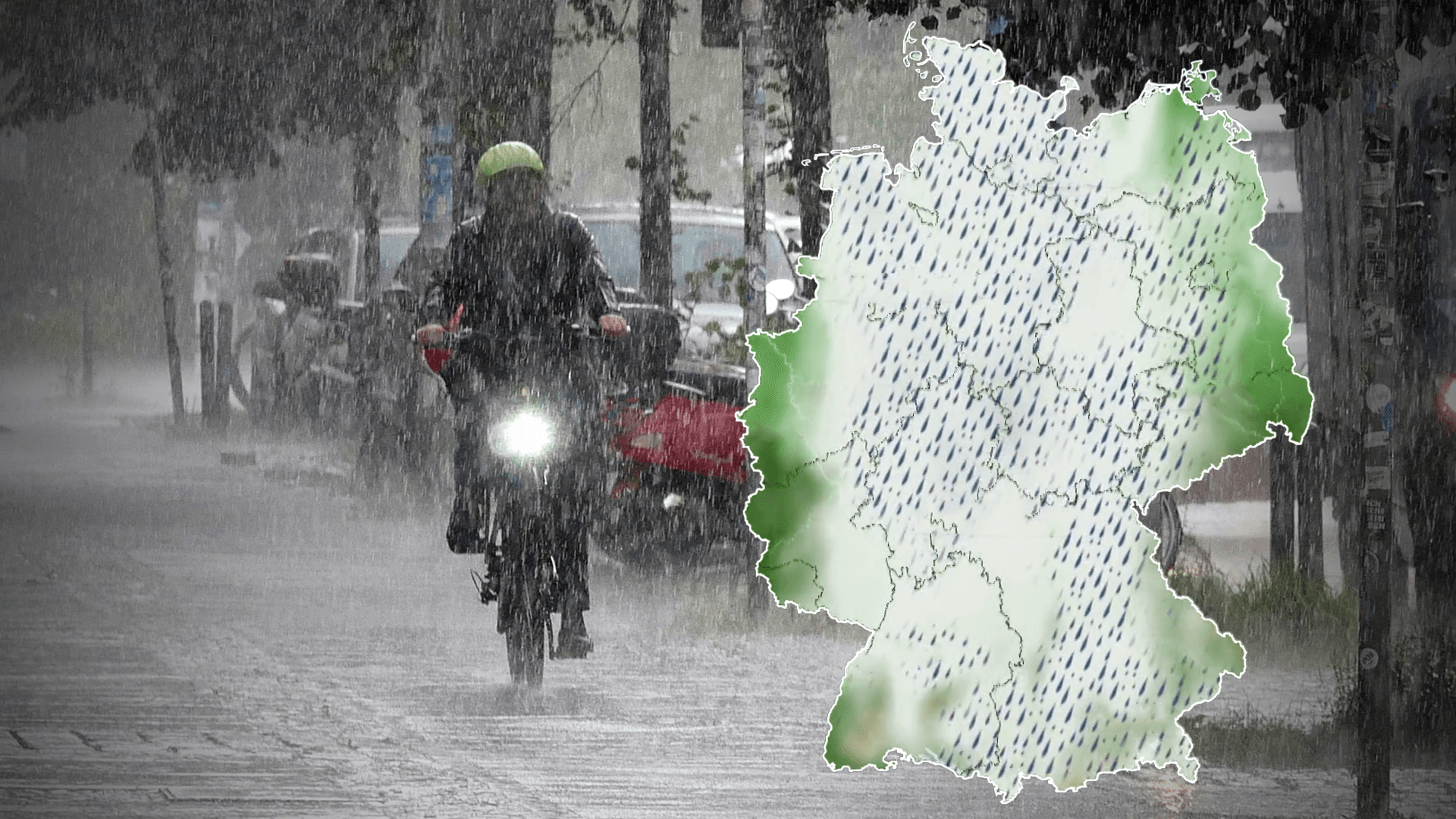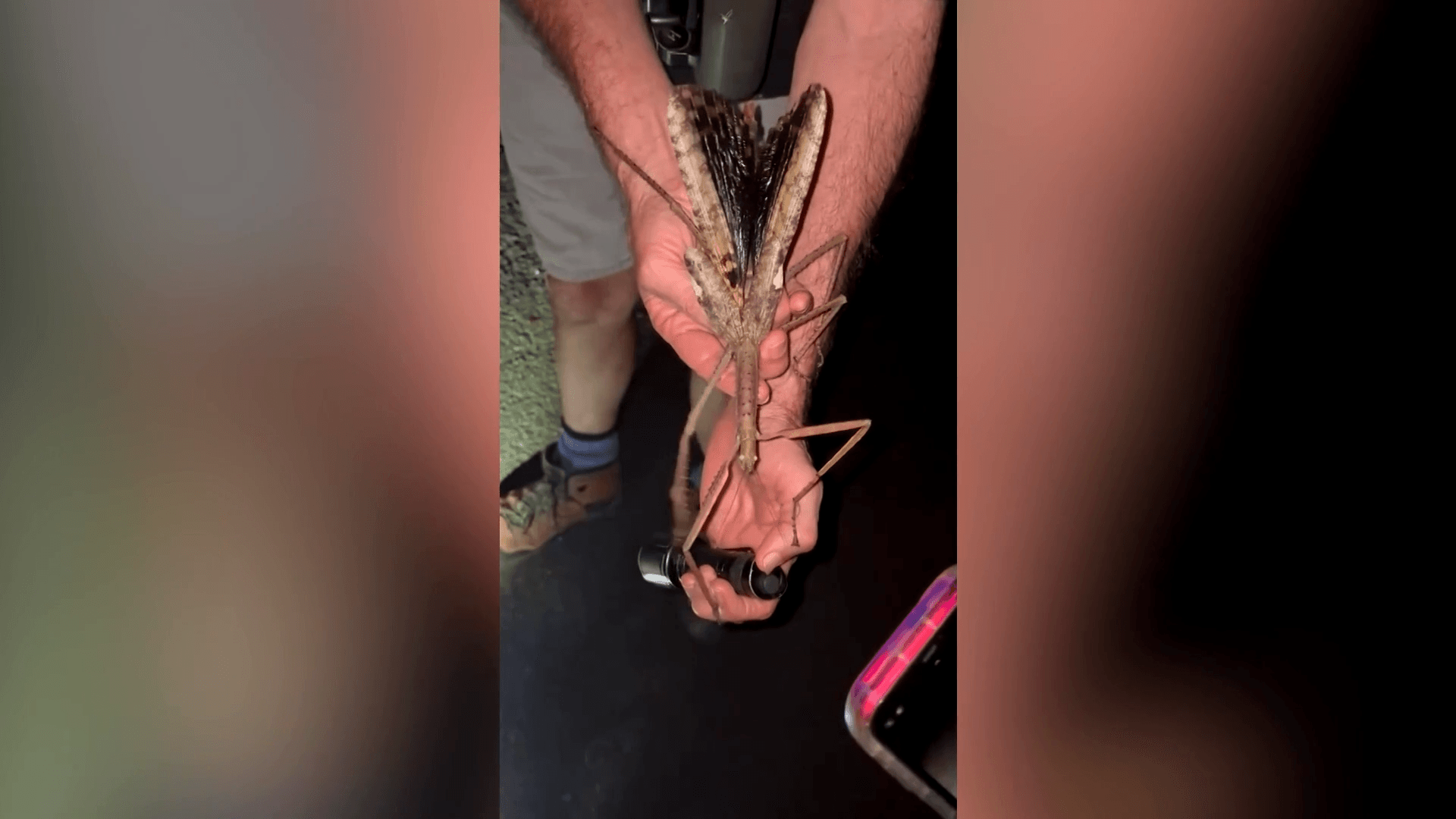Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger "Trump hat ihnen Elektroschock verpasst"


Donald Trump hält seit über 100 Tagen im Amt erneut die Welt in Atem. Der ehemalige Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, wirbt für einen souveräneren Umgang mit dem US-Präsidenten und setzt Hoffnungen in Friedrich Merz.
Er taktiert mit Kremlchef Wladimir Putin und stößt viele europäische Partner vor den Kopf. Donald Trump ist seit dieser Woche in seiner zweiten Amtszeit über 100 Tage US-Präsident, und die Sorgen und der Unmut im westlichen Bündnis sind groß. Trotz des Rohstoffdeals mit der Ukraine könnte die US-Regierung die militärische Unterstützung für die ukrainische Armee zurückfahren und sich allgemein weiter von Europa abwenden. Trump stellt die Europäer vor ein Dilemma, denn sie sind noch immer sicherheitspolitisch von den Amerikanern abhängig.
Wolfgang Ischinger, langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemals deutscher Botschafter in den USA, mahnt jedoch im Umgang mit der Trump-Administration mehr Dialog und weniger Alarmismus an. Im Interview spricht er darüber, dass für Deutschland unter dem kommenden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Möglichkeit besteht, einen Stimmungswechsel in den transatlantischen Beziehungen einzuleiten.
t-online: Donald Trump ist seit dieser Woche 100 Tage im Amt, und vor allem der US-Präsident selbst feiert seine Politik der vergangenen Monate. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie an dieser Wegmarke?
Wolfgang Ischinger: Die Beurteilung hängt unter anderem auch davon ab, ob man über die Innenpolitik oder die Außenpolitik urteilt. Wie die US-Administration etwa mit dem Thema Migration umgeht, ist aus meiner Sicht in erster Linie ein amerikanisches innenpolitisches Thema.
Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus?
Dass wir in Europa uns vor allem auf die Themen konzentrieren sollten, bei denen wir mit den USA zusammenarbeiten wollen oder müssen. Die neue Bundesregierung würde sich völlig zu Recht nicht freuen, wenn ihre Innenpolitik ständig aus Washington kommentiert würde.

Zur Person
Wolfgang Ischinger ist ein deutscher Diplomat und Sicherheitsexperte. Von 2008 bis 2022 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz und ist heute Präsident des Stiftungsrats. Er war Botschafter in den USA und Großbritannien sowie Staatssekretär im Auswärtigen Amt.
Aber die Trump-Administration mischt sich auch in die europäische Innenpolitik ein, besonders in der Migrationsfrage.
Natürlich – und das heißen wir ja auch nicht gut. Klar: Es gibt innenpolitisch in den USA eine ganze Reihe von Vorgängen, die mich als Bürger besorgen. Aber als Außen- und Sicherheitspolitiker ist die Frage, die ich mir stelle: Was kann Europa, was kann Deutschland tun, um an den transatlantischen Beziehungen zu arbeiten? Es gibt Stimmen in Europa, die das transatlantische Verhältnis bereits für endgültig verloren halten und die die USA nicht länger als Partner begreifen. Die sagen, dass Europa nun völlig auf sich selbst gestellt sei. Das würde ich so nicht stehen lassen und in Teilen relativieren wollen. Fakt ist doch: Angesichts unserer außen- und verteidigungspolitischen Defizite bleibt unsere strategische Abhängigkeit von den USA ganz erheblich.
Waren die vergangenen drei Monate dieser neuen US-Außenpolitik kein Warnschuss für Europa?
Noch sind Zehntausende amerikanische Soldaten in Europa stationiert und noch ist keiner abgezogen, noch wird Deutschland von US-Nuklearwaffen geschützt und noch trainieren Ukrainer wie Amerikaner auf deutschen Truppenübungsplätzen. Ja, wir erleben eine zum Teil unerfreulich eskalierende Rhetorik aus Washington, doch zu tatsächlichen Trennungsvorgängen kam es bisher kaum. Diese Diagnose ist zunächst einmal wichtig.
Trotzdem hat sich das transatlantische Bündnis maßgeblich verändert.
Ja, das ist offensichtlich. Wenngleich wir nicht vergessen dürfen: Schon frühere Administrationen haben uns Europäer immer wieder dazu aufgefordert, mehr zur Verteidigung beizutragen – was wir leider versäumt haben. Sie waren oft nur viel freundlicher im Ton. Ja, heute stellt sich die Frage, wie glaubwürdig unser Bündnis überhaupt noch ist. Aus der Sicht von Trump sind wir Europäer anscheinend nicht die vertrauenswürdigsten Partner. Im Gegenteil: Aus seiner Perspektive nutzen wir die USA ökonomisch und sicherheitspolitisch aus. Manche Äußerungen der US-Regierung dazu sind sicher kritikwürdig oder gar beklagenswert, andere Vorstöße der Administration sind allerdings auch begrüßenswert.
Welche Vorstöße sind begrüßenswert?
Die USA haben zum Beispiel begonnen, mit der russischen und der ukrainischen Seite über eine mögliche Waffenstillstands- oder gar Friedensregelung zu reden. Hätten wir uns das zugetraut? Ich fürchte: nein. Wir Europäer haben in drei Jahren zwar viel pro-ukrainische Rhetorik produziert und auch tatsächlich viel militärische Unterstützung geleistet, aber keinerlei strategischen Plan entwickelt, wie man diesen Krieg zu einem Ende bringen könnte. Putin nimmt uns eben auch nicht als Verhandlungspartner ernst – dafür sind wir aber nun wirklich selbst verantwortlich.
Einen für beide Seiten annehmbaren Plan hat Trump allerdings auch nicht entwickelt. Bisher hat er Wladimir Putin vor allem Zeit verschafft.
Es ist zunächst erfreulich, dass die USA überhaupt die Initiative ergriffen haben. Ist der von Washington eröffnete konkrete Prozess geeignet, einen tragfähigen, dauerhaften Waffenstillstand oder eine echte dauerhafte Friedenslösung herbeizuführen? Darüber kann man in der Tat streiten, und zu Recht streiten. Über diese Themen brauchen wir die ernsthafte Auseinandersetzung mit Washington.
Aber folgt Trumps Ukraine-Politik überhaupt einer Strategie?
Bislang wollte Trump offenbar den russischen Präsidenten charmieren, um einen Deal zu erreichen. Die Ukraine hat er dagegen eher unter Druck gesetzt. Der Versuch, damit zu einem Friedensdeal zu kommen, hat aber bis zur Stunde nicht zum Erfolg geführt


Nun hat die US-Regierung jedoch damit gedroht, sich aus diesem Prozess zurückzuziehen, wenn es zu keiner Einigung kommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Weltmacht USA sich einfach aus dem Vorgang verabschiedet. Sie würden sich damit strategisch selbst schwächen, Trump würde kein gutes Bild abgeben. Ich würde mir wünschen, dass man in Washington zu dem Ergebnis kommt, dass der Druck auf die russische Seite nun steigen muss. Trump hat ja inzwischen selbst die Sorge geäußert, dass er von Moskau womöglich nur hingehalten werde. Vielleicht erkennt Washington dann auch, dass man mit den Europäern stärker ist als im Alleingang. Eine Kontaktgruppe ist überfällig.
In den ersten 100 Tagen von Trumps zweiter Amtszeit haben sehr viele Äußerungen und Maßnahmen aus Washington Vertrauen im transatlantischen Bündnis gekostet. Ist die Ukraine-Politik nur ein Beispiel von vielen?
Ja, das erste bedauernswerte Opfer der aktuellen transatlantischen Stimmungslage ist leider das transatlantische Vertrauen. Der Vertrauensverlust wiegt schwer und ist nicht so einfach zu reparieren, aber es ist auch nicht unmöglich. Das wird beiden Seiten viel Energie und Engagement abverlangen. Aber derartige Krisen können auch immer eine Chance sein.
Ist das nicht Zweckoptimismus?
Nein, das meine ich ernst. Diplomaten sollten immer Optimisten sein. Wir Europäer können auch diese Krise gewinnbringend nutzen. Ausgerechnet Wladimir Putin hat mit seiner Aggressionspolitik dafür gesorgt, dass die Nato inzwischen viel mehr für Verteidigung ausgibt und dadurch insgesamt gestärkt wurde, auch durch den Betritt von Schweden und Finnland. Putin hat diese Entwicklung der Nato provoziert. Und Trump hat jetzt mit seinen Ermahnungen und Drohungen uns Europäern einen Elektroschock verpasst und damit der EU einen fundamentalen Anstoß verpasst, sicherheitspolitisch erwachsen zu werden.
Das müssen Sie erklären.
Der US-Präsident hat dafür gesorgt, dass die Europäische Union beginnt, sich jenseits der Integration mit unserer Sicherheit zu befassen. Macron hat ein Europa gefordert, das uns schützen kann. Vielleicht sagen wir in einigen Jahren: Danke für den Anstoß, dass Europa endlich nicht nur in der Handels- und Agrarpolitik, sondern auch in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik lernen musste, mit einer Stimme zu sprechen.
Europa wird Trump wohl kaum danken, wenn es ständig von ihm politisch attackiert wird.
Eine Sache ist wichtig: Deutschland und Europa dürfen sich von Trump nicht erschrecken lassen, besonders nicht von seiner für uns manchmal befremdlichen Sprache. Seine Auftritte sind oft vor allem an sein amerikanisches Publikum gerichtet. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich einen klugen Satz gehört: Wir nehmen Trump oft nicht richtig ernst, aber wir nehmen ihn viel zu oft wörtlich. Es müsste genau umgekehrt sein.
Warum?
Die europäische Politik muss lernen, über manche markigen Sprüche hinwegzuschauen – und gleichzeitig akzeptieren, dass Trump bestimmte politische Ziele vertritt, die er im Wahlkampf auch präsentiert hat.

Das ist in manchen Fragen schwierig. Immerhin wollte Trump bereits Grönland, Kanada, den Gazastreifen oder den Panamakanal annektieren.
Ich wiederhole: tiefer hängen. Was ist denn bisher konkret passiert? In Kanada hat das eine Stimmung in der Bevölkerung verursacht, in der sich die Wähler hinter dem liberalen Mark Carney – gegen die USA – versammelt haben. Dänemark stärkt sein Engagement und seine Beziehung zu den Grönländern, und die Trump-Vorstöße mit Blick auf den Gazastreifen oder auf Panama sind anscheinend steckengeblieben. Ich kann nicht erkennen, dass Panik für uns ein guter Ratgeber wäre.
Wie sollten wir stattdessen mit der US-Aministration umgehen?
Wir müssen reden. "Engage, engage, engage": Das ist mein Motto für unser "Munich Leaders Meeting", zu dem wir vom 5. bis 7. Mai in Washington, D.C. über 100 transatlantische Entscheidungsträger zusammenbringen. Wir wollen amerikanische und europäische Entscheidungsträger zusammenbringen, damit diese Entfremdungsprozesse in den transatlantischen Beziehungen gebremst werden. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass wir sehr schwierige Diskussionen führen werden müssen. Aber mit dem Zeitpunkt dieser Tagung – immer im Frühjahr nach den US-Präsidentschaftswahlen – haben wir seit 2009 jedes Mal gute Erfahrungen gemacht. Denn nach 100 Tagen hat sich eine Regierung in außenpolitische Positionen eingearbeitet.
Diese Gesprächsangebote hat die US-Administration in den vergangenen Monaten oft abgelehnt. Macht Ihnen das keine Sorgen?
Doch. Aber genau deswegen wollen wir dazu beitragen, dass in den kommenden Monaten die Konflikte weniger werden und hoffentlich wieder etwas Ruhe eintritt. Es braucht dringend Vertrauensaufbau und bestenfalls danach wieder gemeinsamere transatlantische Linien. Die benötigen wir nicht nur handelspolitisch, sondern auch sicherheits- und technologiepolitisch, etwa beim Thema KI, und auch mit Blick auf den Umgang mit China, Russland und anderen Mächten wie dem Iran. Solange wir – Deutschland und Europa – am Ball bleiben, ist es am Ende nicht unsere Schuld, wenn es nicht zur Überwindung des transatlantischen Zerwürfnisses kommt. Wir dürfen niemals die Ersten sein, die vom Verhandlungstisch aufstehen. Das ist wichtig.
Demnach sehen Sie schon die Gefahr, dass sich die Beziehungen zu den USA durch Trump noch weiter verschlechtern könnten?
Nur dann, wenn wir den transatlantischen Beziehungen nicht ausreichend Aufmerksamkeit schenken. Deutschland und Europa müssen also engagiert bleiben.
Macht Ihnen die künftige Bundesregierung in dieser Frage Hoffnung?
Deutschland hat eine große Chance. Friedrich Merz und Donald Trump tragen im persönlichen Verhältnis keine Last mit sich herum. Deshalb kann ein Besuch des künftigen Kanzlers in den USA rasch zu einer Verständigung und zu einer besseren Arbeitsatmosphäre führen. Merz könnte es wie Macron gelingen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen – und das wäre wichtig: Denn für Trump zählt kaum etwas so stark wie persönliche Sympathie. Wenn Merz hier erfolgreich ist, wäre das mit Blick auf die Zukunft ein wichtiges Zeichen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ischinger.
- Gespräch mit Wolfgang Ischinger