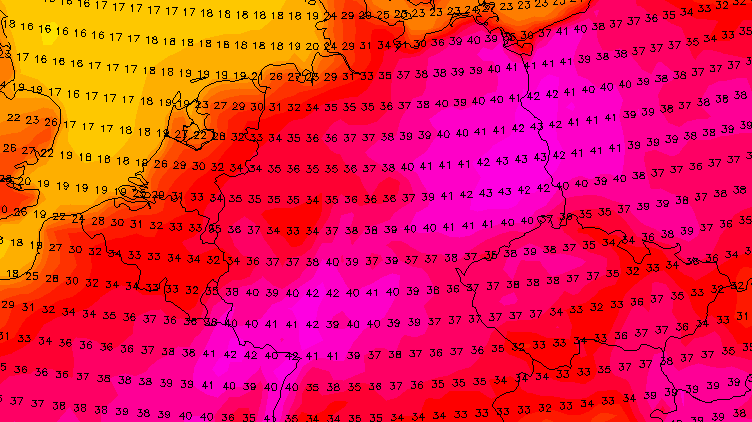Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Lage der Nation Eine brutale Rede
Der Bundespräsident hält eine Rede zur Lage der Nation und spricht bemerkenswert schonungslos. Mit einer Ausnahme – und die betrifft ausgerechnet ihn selbst.
Am Ende breitet Frank-Walter Steinmeier die Arme aus, so wie ein Pfarrer, der zu seiner Gemeinde spricht. Doch anders als in der Kirche mischt sich in seine letzten Worte schon der Applaus. Steinmeier lächelt, Steinmeier zieht verschmitzt die Augenbrauen hoch, Steinmeier scheint zufrieden.
Zufrieden mit sich und seiner Rede, nicht mit der Weltlage, damit ist der Bundespräsident ganz und gar nicht zufrieden. So viel sollte den Zuhörern im Schloss Bellevue und in den heimischen Wohnzimmern nach knapp 45 Minuten sehr deutlich geworden sein. Kein Wunder, denn diese Rede zur Lage der Nation, wie sie vorher selbstbewusst genannt wurde, wird am Freitagvormittag ja nur gehalten, weil der Schlamassel so groß ist, in dem diese Nation und die Welt stecken.
Steinmeier wollte mit seiner Rede den vielen Krisen, den Entbehrungen, den Zweifeln, ja auch der Wut etwas entgegensetzen. Mit dem Titel "Alles stärken, was uns verbindet" war sie überschrieben, was tatsächlich etwas nach Predigt klingt. Doch der Titel täuscht, auch wenn das Bemühen um Zusammenhalt natürlich ehrlich gemeint und streckenweise pastoral vorgetragen ist.
Doch eigentlich hält der Bundespräsident eine brutale Rede. Brutal ehrlich. Mit brutalen Zumutungen für jeden Einzelnen. Und gerade weil das so ist, fällt Steinmeiers blinder Fleck dann doch wieder mal auf.
Plötzlich ist da der Krieg
Es sind alles andere als leichte Monate gewesen, auch für den Bundespräsidenten nicht, selbst wenn der bestimmt kein Mitleid braucht im Schloss Bellevue. Kurz nachdem Steinmeiers zweite Amtszeit im Frühjahr gestartet war, griff Wladimir Putin die Ukraine an. Plötzlich war Krieg in Europa, dabei hatte der Bundespräsident doch ganz andere Pläne.
Raus ins Land wollte er, mit den Menschen diskutieren, ihre Probleme verstehen. Er fuhr nach Quedlinburg, nach Rottweil, nach Neustrelitz und nach Altenburg, was sicher lobenswert und wichtig ist.
Und doch konnte man sich von Städtetrip zu Städtetrip etwas ratloser fragen, warum Steinmeier es eigentlich nicht wirklich schafft, den Deutschen in Zeiten der Krisen irgendetwas zu sagen, das ihnen allen in Erinnerung bleibt – und eben nicht nur den Quedlinburgern.
Dafür gibt es wahrscheinlich Gründe. Und Steinmeiers blinder Fleck, von dem später noch die Rede sein wird, spielt wohl eine wichtige Rolle dabei. Doch die gute Nachricht ist erst einmal: Die gefühlte Sprachlosigkeit hat der Bundespräsident mit dieser Rede überwunden.
Eine Zerreißprobe
Nur, was könnte von diesem Freitag in Erinnerung bleiben? Vielleicht das: Der Bundespräsident fordert sein Volk. Er ist ehrlich mit ihm, beschreibt dessen gewaltige Probleme ungeschönt – und verlangt ihm etwas ab. Ziemlich viel sogar.
Steinmeier wiederholt seine Deutung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als "Epochenbruch". Viel größer wird es nicht mehr, und entsprechend groß sind die Konsequenzen. "Die neue Zeit fordert uns heraus wie lange nicht mehr", sagt er.
Steinmeier spricht von der "tiefsten Krise" des wiedervereinigten Deutschland, von einem "Scheidepunkt", an dem es nun stehe und von einer "Zerreißprobe, die uns keiner abnimmt und für die es keinen einfachen Ausweg gibt".
Der Bundespräsident gesteht sogar seine eigene Ohnmacht ein. "Politik kann keine Wunder vollbringen", sagt er. Niemand könne alle Sorgen nehmen. "Im Gegenteil: Ich glaube, dass viele der Sorgen berechtigt sind."
Angenehmer wird es erst mal nicht mehr
Das ist bemerkenswert schonungslos und ziemlich düster. Und es wird nicht angenehmer. Klar, irgendwann am Ende, kurz bevor er seine Arme ausbreitet, sagt der Bundespräsident natürlich, dass Deutschland die Kraft habe, diese Krisen zu überwinden.
Aber, und das ist sein Hauptpunkt: Nur, wenn gewissermaßen mal wieder in die Hände gespuckt wird. "Diese neue Zeit, sie fordert jeden Einzelnen", sagt er und meint damit die jetzige "Epoche im Gegenwind", die auf die vergangene "Epoche mit Rückenwind" gefolgt sei.
Und dieser Einzelne, der hat jetzt eben viel zu tun, wenn es nach Steinmeier geht. Die Politik könne man nun nicht mehr den anderen überlassen, findet er. Und: "Wir müssen in den nächsten Jahren Einschränkungen hinnehmen." Die Energiekrise lässt grüßen.
Wer sich danach Besserung erhofft, den muss Steinmeier erneut enttäuschen: "Mit diesem Winter ist es nicht getan", sagt er. Denn die Klimakrise gibt es ja auch noch. Und die Demokratie insgesamt, die steht dummerweise ebenfalls unter Druck. Um sie zu schützen, brauche es "widerstandskräftige Bürger".
Man kann das alles der Lage angemessen finden oder doch etwas zu wenig ermutigend, zu wenig aufrüttelnd. Eines ist es aber ganz bestimmt: unbequem – und damit durchaus mutig.
Der blinde Fleck
Was zu Steinmeiers blindem Fleck führt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs steht er nämlich selbst in der Kritik. Nicht für sein Handeln als Bundespräsident, sondern für sein Wirken zuvor als Außenminister unter Angela Merkel und davor als Kanzleramtschef von Gerhard Schröder.
Steinmeier stand wie kein zweiter für eine Russlandpolitik, die inzwischen als vollends gescheitert gilt. Einen "unentbehrlichen Partner" nannte er Russland einmal und verteidigte die Pipeline Nord Stream 2 als "fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa".
Diese Äußerungen flogen ihm zu Beginn des russischen Angriffs gleich um die Ohren. Als der Bundespräsident die Ukraine bereisen wollte, wurde er ausgeladen. Der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf Steinmeier irgendwann vor, "ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft" zu haben. Etwas "Fundamentales, ja Heiliges" bleibe das Verhältnis zu Russland für Steinmeier.
Das war natürlich sehr schrill, klar. Doch es traf bei Steinmeier eben einen wunden Punkt. Irgendwann wurde der Druck so groß, dass er ihm nachgeben musste. Das Festhalten an Nord Stream 2 bezeichnete er als "Fehler", in Putin habe er sich "geirrt" – mit der Einschränkung: "wie andere auch".
Manche hielten das schon damals für halbherzig, die jetzige Rede zur Lage der Nation wird die Kritiker nicht vom Gegenteil überzeugen. Die friedlichen sowjetischen Truppen bei der Wiedervereinigung, sagt Steinmeier an einer Stelle, hätten Hoffnung gemacht auf eine friedliche Zukunft. "Diese Hoffnung hatte auch ich, und sie war Antrieb für meine Arbeit in vielen Jahren."
Diese Hoffnung von früher stellt er dann dem "Russland von heute" gegenüber. Da sei nun "kein Platz für alte Träume" mehr, sagt er. Ehrliche Hoffnung als Antrieb, und heute weiß man es eben besser: So hört es sich nicht an, wenn man einen Fehler eingestehen will.
Olle Kamellen? Alles vergeben und vergessen? Das kann man so sehen. Aber wer Einschränkungen von den Menschen einfordert, die weniger hart sein könnten, wenn die Abhängigkeit von Russland nicht so groß gewesen wäre, der könnte glaubwürdiger sein, wenn er sich selbst auch etwas abverlangt: Selbstkritik.
- Rede von Frank-Walter Steinmeier am 28. Oktober
- bundespraesident.de: "Alles stärken, was uns verbindet"
- bundespraesident.de: "Ortszeit Deutschland"
- tagesschau.de: Bundespräsident zu Russlandpolitik: "Ich habe mich geirrt"
Quellen anzeigen