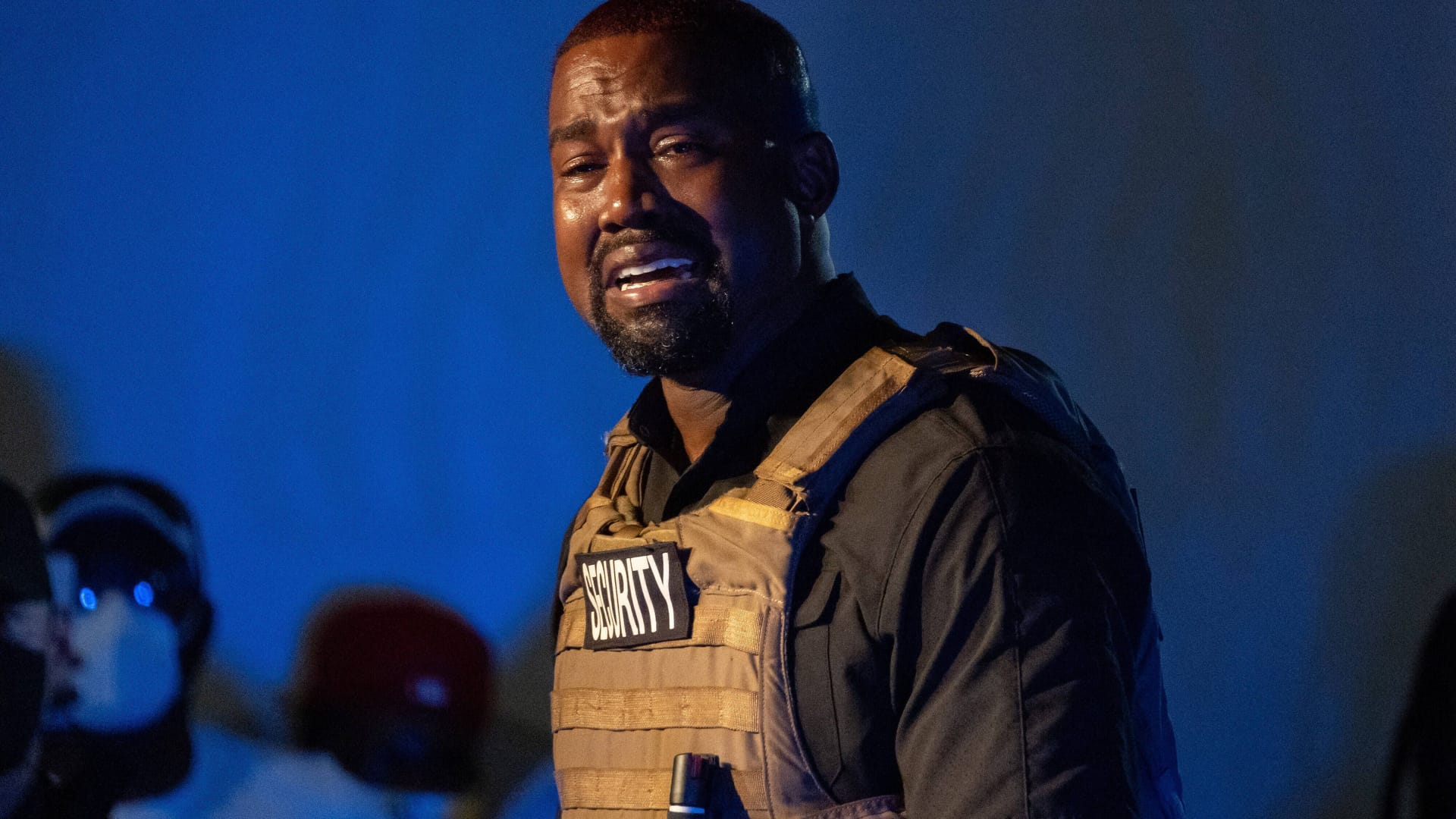Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Schwarz-Rot Das könnte schiefgehen


Schwarz-Rot will am Freitag im Bundestag drei neue Verfassungsrichter wählen lassen. Nur klappt das auch? Eine Kandidatin halten viele in der Union für zu links. Und das ist nicht das einzige Problem.
Sie sind nicht glücklich damit, gar nicht glücklich. Wenn der Bundestag am Freitag drei neue Verfassungsrichter wählen soll, wird die Laune bei der Union ausbaufähig sein. Um es höflich zu formulieren. Denn eine passt vielen dort gar nicht: Frauke Brosius-Gersdorf, 54 Jahre alt, Rechtsprofessorin an der Universität Potsdam.
Als "nicht wählbar", weil "ultralinks" wird die Juristin seit Tagen aus den Reihen der Union kritisiert. Meist hinter vorgehaltener Hand, nur wenige machen ihre Kritik öffentlich. Die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig hat damit keine Probleme. Sie schreibt auf der Plattform X, Brosius-Gersdorf sei "maximal ungeeignet und für jeden Demokraten unwählbar".
Die Sache ist äußerst heikel, aus vielen Gründen. Ein besonders naheliegender: Die Wahl könnte leicht schiefgehen. Union und SPD, die die drei Neuen diesmal vorschlagen dürfen, haben selbst nicht mal mit den Grünen die nötige Zweidrittelmehrheit für die Wahl zusammen. Wenn jetzt auch noch die eigenen Leute rebellieren, könnte die schwarz-rote Koalition schnell blamiert dastehen. Und das soll auf keinen Fall passieren.
Übliches Verfahren macht Probleme
Es war die SPD, die Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen hat, neben der Rechtsprofessorin Ann-Katrin Kaufhold. Die Union wiederum will am Freitag Günter Spinner wählen lassen, der bisher als Richter am Bundesarbeitsgericht arbeitet. Es war das Paket, auf das sich die Koalitionsspitzen verständigt hatten.
Die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts ist eigentlich ein wohleingeübtes Verfahren. Am Bundesverfassungsgericht arbeiten 16 Richter in zwei Senaten, die zu verschiedenen Zeiten und zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Das Vorschlagsrecht im Bundestag haben seit 2018 die Union (für drei Kandidaten), die SPD (drei Kandidaten), die Grünen (einen Kandidaten) und die FDP (einen Kandidaten).
Das hat es lange relativ einfach gemacht, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Zumal Regierungskoalitionen im Bundestag traditionell gemeinsam abstimmen. Nun aber ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag vertreten. Und Union, SPD und Grünen fehlen zusammen sieben Stimmen zur Zweidrittelmehrheit – sofern alle anwesend sind. Denn nur die Anwesenden zählen bei dieser Wahl für die Mehrheit.
Ein Szenario, das in der Union kursiert, geht deshalb so: Solange Union, SPD und Grüne vollständig sind, könnten ihre Stimmen zusammen am Ende schon reichen: Dann jedenfalls, wenn bei Linken und AfD an diesem Freitag, dem letzten vor der Sommerpause, ausreichend Abgeordnete fehlen.
Unionsspitze wirbt in eigenen Reihen
Hoffen, dass bei den anderen schon genug im Urlaub sind? Es ist eine äußerst wacklige Lösung. Und vor allem eine, die Union und SPD nicht in der Hand haben. Deshalb werben die Spitzen der Union seit Tagen in den eigenen Reihen dafür, am Freitag für alle Kandidaten zu stimmen.
"Wir unterstützen die Vorschläge auch der SPD", sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn am Montag vor der Fraktionssitzung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann mahnte, es gehe "um die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie".
Selbst der Bundeskanzler schaltete sich am Mittwoch ein: "Wir sollten selbst stark genug sein, eine entsprechende Mehrheit für weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu finden", sagte Friedrich Merz bei der Regierungsbefragung.
Öffentlicher Druck auf die eigenen Leute, der ergänzt wird von internem Druck auf jeden Einzelnen. Wer Bauchschmerzen hat, soll sich bei der Unionsführung melden – um dann doch noch zur Zustimmung überredet zu werden.
Die Nervosität in der Unionsführung ist groß. Dass es überhaupt eine solch große Debatte gibt, macht viele höchst unglücklich. Immerhin lehrt der Blick in die USA, dass ein Parteienstreit um das Verfassungsgericht wirklich niemand wollen kann.
Für ein AfD-Verbotsverfahren
Der Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf werden aus der Union gleich mehrere Dinge vorgeworfen, und von noch weiter rechts sowieso. In Gesprächen mit Unionsabgeordneten werden besonders oft zwei Stichpunkte genannt: AfD-Verbot und Abtreibungen.
Zur AfD hat sich die Professorin vor einem Jahr bei "Markus Lanz" positioniert, im Fernsehen. "Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird", sagte Brosius-Gersdorf dort. "Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen."
Es ist eine Position, die sehr viele in der Union nicht teilen. Die meisten aber, weil sie ein Verbotsverfahren für politisch unklug halten, für kontraproduktiv. Nicht, weil es eine verfassungswidrige Position wäre.
Erfahrene Unionspolitiker weisen jedoch auch auf das zweifelhafte Signal hin, das so entstehe: Ausgerechnet die SPD, die sich stark für ein Verbotsverfahren einsetzt, beruft eine Richterin mit gleicher Ansicht ins Bundesverfassungsgericht – das dann wiederum über ein Parteienverbot entscheiden müsste.
Positionen zu Abtreibungen und Impfpflicht
Beim Thema Abtreibungen entzündet sich der Widerspruch vor allem an Brosius-Gersdorfs Beteiligung an der "Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin". Sie ist von der Ampelregierung eingesetzt worden, um Möglichkeiten auszuloten, Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln.
Im Bericht schreibt Brosius-Gersdorf in einem von ihr verantworteten Kapitel unter anderem: "Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt." Es ist der Satz, der ihr jetzt vorgehalten wird, und in der Tat klingt er hart. Der Bundeskanzler selbst hat die Debatte am Mittwoch aus Sicht einiger in der Union noch mal komplizierter gemacht. Da wurde Merz im Plenum von der AfD gefragt, ob er mit seinem Gewissen vereinbaren könne, eine Richterin zu wählen, die das vertrete. Und Merz antwortete schlicht mit: "Ja."
Allerdings relativiert sich Brosius-Gersdorfs Satz deutlich, wenn man mehr Sätze als nur diesen einen in dem Kapitel liest. Die Rechtsprofessorin schreibt nämlich auch Dinge wie: "Bei einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs hat der Gesetzgeber Schutzpflichten für das Grundrecht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) des Embryos/Fetus (jedenfalls) ab Nidation." Also ab dem Zeitpunkt, an dem sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut einnistet.
Brosius-Gersdorf wägt das Lebensrecht des Ungeborenen und die Grundrechte der Schwangeren gegeneinander ab, so wie Rechtswissenschaftler das tun, wenn zwei Grundrechte in Konflikt geraten. Und kommt unter anderem auch zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber die Abtreibung in der Spätphase der Schwangerschaft "grundsätzlich als rechtswidrig" einstufen "muss".
Die Union aber hält die ganze Debatte über den Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches für falsch. Sie wollen, dass er bleibt und Abtreibungen grundsätzlich strafbar bleiben, mit den Ausnahmen, die es bisher schon gibt.
Genauso sind viele in der Union sehr entschieden gegen eine andere Position, die Brosius-Gersdorf in der Coronapandemie sehr entschieden vertreten hatte. Damals plädierte sie mit ihrem Mann in einem Papier für eine allgemeine Impfpflicht. Und schrieb unter anderem, es sei "Aufgabe des Staates", die freiwillig Geimpften davor zu schützen, "dass ihre Gesundheit, ihre persönliche Freiheit sowie ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz weiterhin von Ungeimpften bedroht wird".
Sie ist nicht das einzige Problem
Mancher in der Union kritisiert nun hinter vorgehaltener Hand, die Fraktionsspitzen von Union und SPD hätten diese Dinge vorher bemerken und Brosius-Gersdorf gar nicht erst aufstellen dürfen. Dann nämlich, als sie hinter verschlossenen Türen das Personalpaket ausgehandelt haben, wie es üblich ist. Ein handwerklicher Fehler der jungen Regierungskoalition also.
Doch Brosius-Gersdorf ist nicht das einzige Problem für die schwarz-rote Koalition bei dieser Richterwahl. Es ist auch das Verhältnis der Union zu Linkspartei und AfD. Besser gesagt: das Nicht-Verhältnis. Union, SPD und Grünen fehlen eben sieben Stimmen zur nötigen Zweidrittelmehrheit – nicht nur für Brosius-Gersdorf, sondern für alle Kandidaten.
Von der AfD möchte sich eigentlich niemand abhängig machen. Mit der Linken will die Union aber auch nicht sprechen und appelliert stattdessen an ihre Verantwortung für die Demokratie. Die Linke wiederum will unbedingt, dass mit ihr geredet wird, wenn sie schon mitstimmen soll. Man sei ja kein Stimmvieh.
Die SPD hat traditionell kein Problem damit, mit der Linken zu reden. Deshalb will die Linke ihre Kandidatinnen auch unterstützen. Mit den mehr als 60 Linken-Abgeordneten könnte sie Brosius-Gersdorf so zur Mehrheit verhelfen, selbst wenn eine zweistellige Zahl von Unionsabgeordneten nicht für sie stimmt. Was in der Union durchaus für möglich gehalten wird.
Nur: Stimmt die Linke auch für den Unionskandidaten? Oder wird der letztlich auf Stimmen aus der AfD-Fraktion angewiesen sein? Wie sie sich entscheiden, wollen die Linken erst am Freitagmorgen in einer Sonderfraktionssitzung besprechen. Legen sie sich nicht fest, könnte es auch sein, dass letztlich niemand weiß, wer für wen gestimmt hat. Denn die Richterwahl im Bundestag ist geheim.
- Eigene Recherchen und Gespräche
- zdf.de: "Markus Lanz vom 25. Juli 2024"
- uni-potsdam.de: "Stellungnahme zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht" (PDF-Datei)
- bundesgesundheitsministerium.de: "Kurzbericht der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin" (PDF-Datei)
Quellen anzeigen