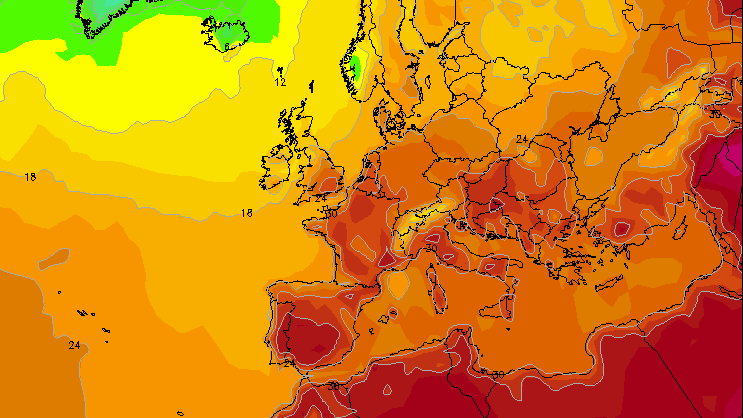Es geht auch um Ihr Geld Hier könnte es knallen


Zoff wie zu Ampel-Zeiten sollte es zwischen Union und SPD eigentlich nicht geben. Doch nach der Sommerpause dürfte ein heißer Herbst folgen.
Ein Politikwechsel sollte her: Nicht nur inhaltlich, auch in Sachen Stil wollte sich die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz von der dauerstreitenden Ampel abheben. Doch wie schwierig es ist, im politischen Alltag die Ruhe zu bewahren, machte die Kontroverse um die Verfassungsrichterwahl deutlich.
Nicht nur dieses Thema dürfte nach der Sommerpause erneut zur Belastungsprobe für die Koalitionäre von CDU/CSU und SPD werden. Dringend notwendig ist beispielsweise auch eine Modernisierung der Sozialsysteme. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kündigte bereits einen "Herbst der Reformen" an und meint damit wohl vor allem Einsparungen beim Bürgergeld. Doch bei der genauen Ausgestaltung droht Streit mit dem Koalitionspartner – genauso wie bei Reformen im Gesundheitssystem, bei der Rente und beim Achtstundentag. Ein Überblick über mögliche Konfliktfelder.
Richterwahl: Jede Menge Sprengstoff
Es ist derzeit das Thema mit der größten Sprengkraft für die schwarz-rote Koalition: die Wahl der neuen Richter für das Bundesverfassungsgericht. Über die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf hatte man sich kurz vor der Sommerpause öffentlich zerlegt, die Wahl von insgesamt drei Richtern dann verschoben. Ruhe wollte trotzdem nicht einkehren, der Ärger schwelt. Ex-CSU-Chef Erwin Huber sprach Klartext, kritisierte seine Union für einen "taktischen Fehler" und gab den Tipp: "Jetzt cool down bis September. Empfehle allen, mal das Maul zu halten, das wäre hilfreich."
Ablehnung in der Union erntete Brosius-Gersdorf offiziell wegen Plagiatsvorwürfen, die inzwischen ausgeräumt sind. Stärker aber noch verstimmt viele Christdemokraten ihre Position zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen. Für einen Teil bei CDU/CSU gilt sie deswegen inzwischen als unwählbar. In der Kritik steht auch Unions-Fraktionschef Jens Spahn, der die Mehrheit für die Wahl organisieren sollte und das offenbar nicht vorhergesehen hat. Bei der SPD hält man hingegen an der von ihr nominierten Kandidatin fest, Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil betonte das zuletzt. Die Wahl soll nach der Pause, vermutlich im September, stattfinden. Ausgang: ungewiss.
Bundeshaushalt: In der Ausgabenfalle
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition werden nicht müde, zu betonen: Der kommende Herbst wird eine Belastungsprobe für die Regierung. Milliardenlöcher bei Pflege- und Krankenkassen, Reformstau beim Bürgergeld und der Rente, eine schwächelnde Wirtschaft – die Aufgaben, vor denen die Koalition steht, könnten kaum größer sein. Dazu kommen zwei Bundeshaushalte (2025 und 2026), die Union und SPD durch das Parlament bringen müssen und die nicht allen gefallen. Mit Verteilungskämpfen im Bundestag um Einzelposten und Lieblingsprojekte ist zu rechnen.
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte die Entwürfe zu den beiden Haushaltsgesetzen innerhalb weniger Wochen durch das Kabinett gepeitscht. Bei der Vorstellung des Haushalts 2026 am Mittwoch kündigte Klingbeil einen harten Sparkurs an – und appellierte auch an seine Kabinettskollegen, ihre Etat-Extrawünsche zu begraben. "Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen", so Klingbeil.
Der dringliche Aufruf des Finanzministers hat einen einfachen Grund: Bis 2029 fehlen der Regierung gigantische 172 Milliarden Euro. Trotz milliardenschwerer Sondervermögen für Infrastruktur, Klima und Verteidigung steckt die Koalition in einer Ausgabenfalle. Schon 2027 sieht es düster aus: Dann klafft eine Finanzlücke von über 30 Milliarden Euro. Wer sich erinnert: Die Ampel zerbrach an einem Haushaltsloch über wenige Milliarden. Die Geldnot von Schwarz-Rot ist deutlich größer – und könnte die Statik der Koalition ernsthaft gefährden.
Bürgergeld
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor nicht einmal drei Jahren das Bürgergeld eingeführt – jetzt soll Heils Nachfolgerin Bärbel Bas (SPD) es schon wieder abschaffen. Friedrich Merz hatte schon in der Opposition lautstark gegen die Ampel-Reform des Arbeitslosengelds II (Hartz IV) getrommelt. Als Kanzler will er nun das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Sie soll scharfe Sanktionen für Arbeitsverweigerer und gedeckelte Mieten beinhalten. Der SPD, die mit dem Bürgergeld "entwürdigende Sanktionen" einschränken und Armut verhindern wollte, steht jetzt eine demütigende Kehrtwende bevor.
Mit der erneuten Reform beabsichtigt die Bundesregierung, bis 2027 knapp fünf Milliarden Euro bei der Sozialhilfe einzusparen. Laut Andrea Nahles, ehemalige Chefin der SPD und heute Vorstandsvorsitzende der Agentur für Arbeit, wäre das nur schaffbar, wenn Hunderttausende Empfänger vollständig aus dem System ausscheiden würden. Dafür bräuchte es "wirtschaftlichen Rückenwind", so Nahles.
Der ist jedoch bislang kaum spürbar, und die Arbeitslosenzahl ist jüngst auf knapp drei Millionen gestiegen. Die Union könnte mit ihren selbst gesteckten Zielen also nicht nur an einem unwilligen Koalitionspartner scheitern, sondern auch an der stotternden Volkswirtschaft.
Krankenkassen in Finanznot
Die Ausgaben der Krankenversicherungen steigen immer weiter an – und damit auch die Beiträge der Versicherten. Dabei hat ein Großteil der Kassen diese erst zu Jahresbeginn angehoben. Das aktuelle Finanzierungsmodell funktioniert nicht. Die Regierung ist sich bewusst, dass sie hier reagieren muss. Doch die Koalitionspartner haben unterschiedliche Ansichten, wie das funktionieren soll.
Die SPD fordert dabei höhere Beiträge für Gutverdiener als Möglichkeit, die Einnahmen zu steigern. Das lehnt die Union ab. Merz deutete dagegen jüngst an, Leistungen kürzen zu wollen. Dagegen sperren sich aber die Kassen. Eine Lösung ist nicht in Sicht – auch weil die Regierung sowohl bei der Kranken- als auch bei der Pflegeversicherung viel an Kommissionen und Arbeitsgruppen in die Zukunft delegiert hat. Doch damit wird der Streit maximal vertagt.
Rente: Immer gut für einen Aufreger
Auch die Altersvorsorge steht auf immer wackligeren Füßen. Zwar kündigen sich Beitragserhöhungen in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht so unmittelbar an wie bei der Kranken- und Pflegeversicherung, absehbar sind sie dennoch: Laut Vorausberechnungen soll der Beitragssatz bis 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben, 2028 geht die Bundesregierung jedoch von einem Anstieg auf 20 Prozent aus. 2035 könnte er bereits bei 22,3 Prozent liegen.
Reformen, die diese Entwicklung eindämmen, sind zumindest offiziell nicht in Sicht – im Gegenteil. Vorhaben wie ein festes Rentenniveau und die Ausweitung der Mütterrente verursachen zusätzliche Kosten. Doch auch wenn über echte Strukturreformen erst eine Rentenkommission nachdenken soll, halten einzelne Regierungsmitglieder nicht mit ihrer persönlichen Meinung hinterm Berg. Jüngstes Beispiel: CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, die sich offen für ein höheres Renteneintrittsalter zeigte.
Im Koalitionsvertrag wird genau das jedoch zugunsten der Aktivrente ausgeschlossen, die Ältere freiwillig zur Weiterarbeit bewegen soll. Gut möglich, dass das Rentenalter trotzdem noch einmal auf die Agenda kommt. Denn auch bei der zuständigen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) scheint der Widerstand gegen eine Anhebung zu bröckeln. Paaren wird sie die Diskussion aber sehr wahrscheinlich mit einem anderen kontroversen Vorschlag: der Einführung einer Erwerbstätigenversicherung, in die auch Beamte, Selbstständige und Abgeordnete einzahlen. Eine Forderung, mit der sie den Koalitionspartner bereits kurz nach Amtsantritt aufgeschreckt hatte.
Arbeitszeitgesetz: Ende des Achtstundentags?
Die Deutschen sollen insgesamt mehr arbeiten. Dafür plant die Bundesregierung unter anderem eine Reform des Arbeitszeitgesetzes – weg von einer täglichen, hin zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. So einig, wie sich Union und SPD darüber zumindest laut Koalitionsvertrag zu sein scheinen, so verhärtet sind die Fronten bei ihren klassischen Klientelen.
Während Arbeitgeberverbände das Vorhaben als "überfällig" und "notwendig" begrüßen, fürchten Gewerkschaften, dass Unternehmen die größere Flexibilität ausnutzen könnten, um die tägliche Arbeitszeit massiv zu erhöhen. Der Achtstundentag dürfe nicht angetastet werden. Ein Sozialpartnerdialog soll nun bis Mitte Oktober eine Lösung finden, mit der beide Lager zufrieden sind. Schwer vorstellbar, dass CDU/CSU und SPD die Gespräche unkommentiert lassen werden.
- Eigene Recherche
- Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD
- deutschlandfunk.de: "Reform der Altersvorsorge – Wie sich das Rentensystem in Deutschland verändern soll"
- table.media: "Reform der Arbeitszeit: Verhärtete Fronten vor Sozialpartnerdialog" (kostenpflichtig)
- dgb.de: "Breite Mehrheit der Beschäftigten für Achtstundentag und klare Grenzen für Arbeitszeiten"
Quellen anzeigen