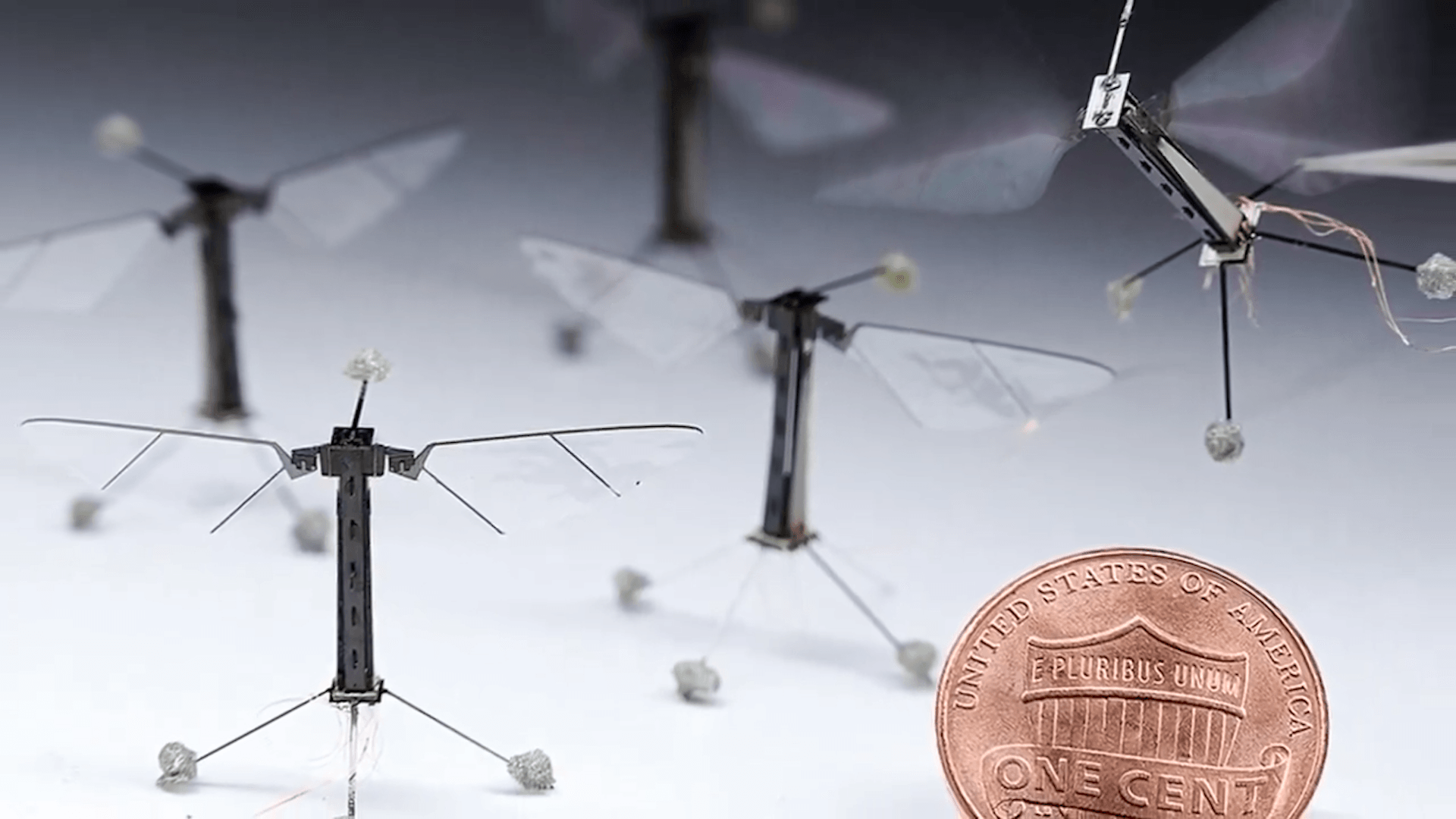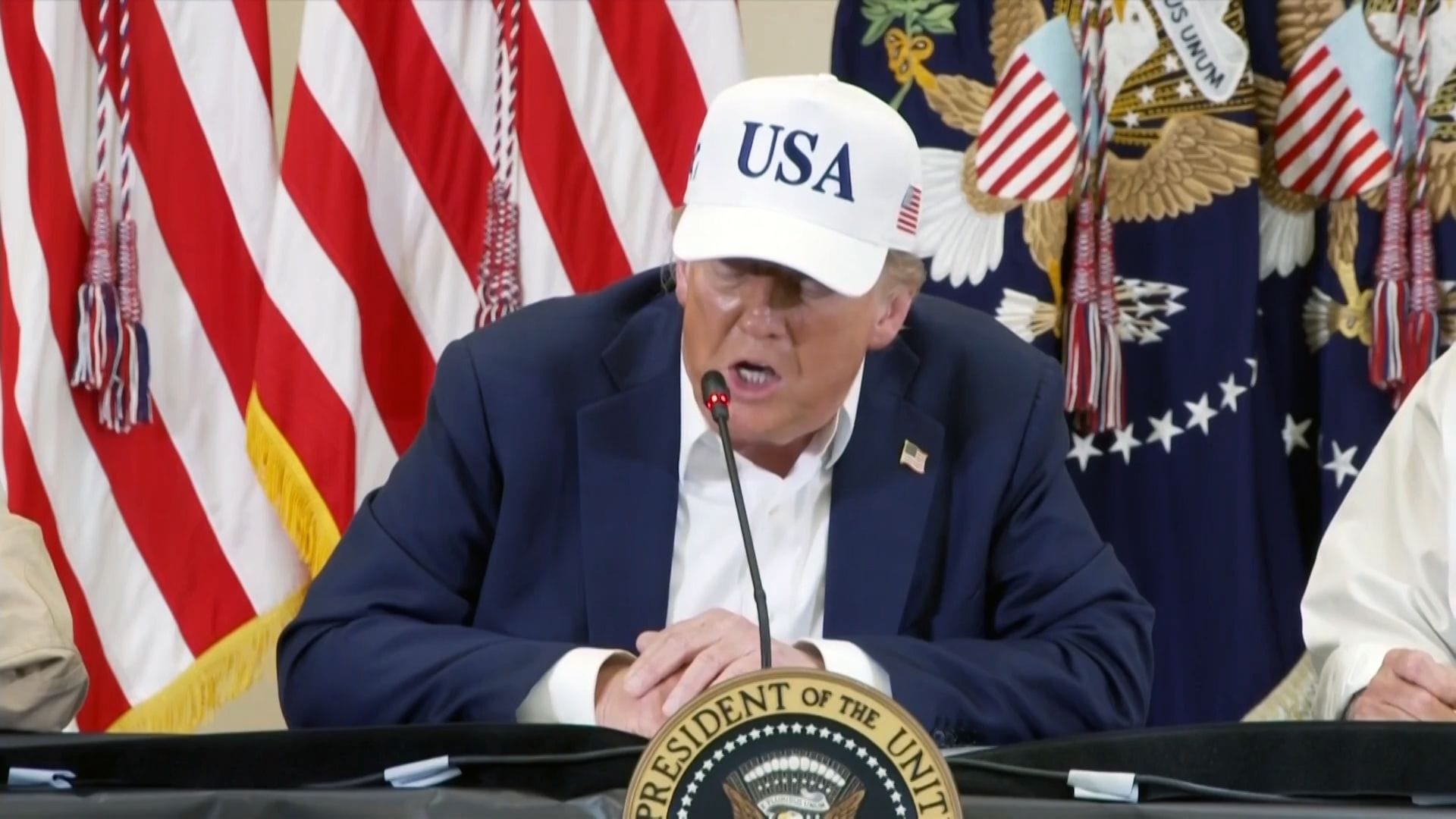Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Umbau der USA "Ein Plan, der weit über die Präsidentschaft hinausgeht"
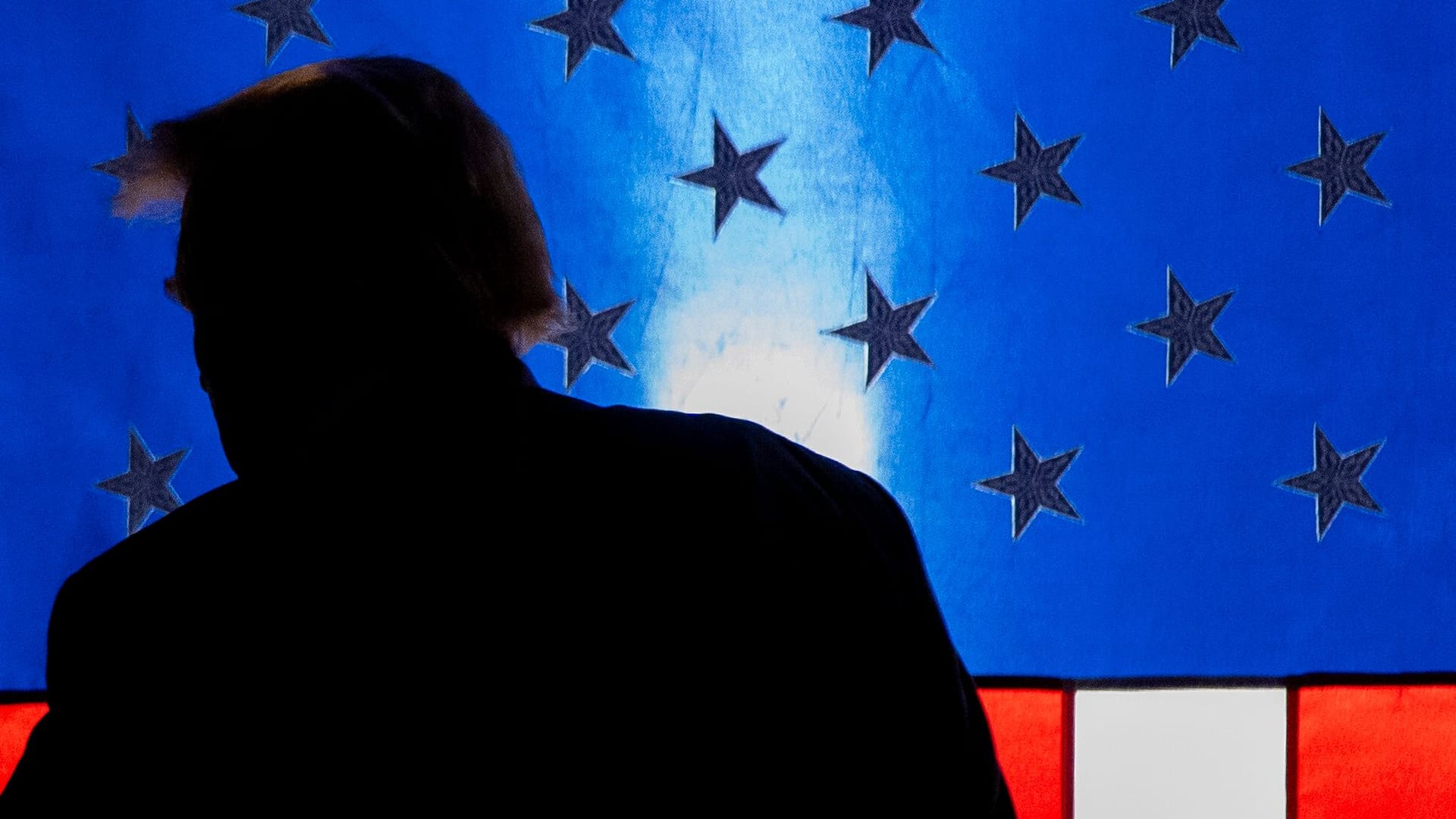

Donald Trumps Politik wirkt erratisch bis chaotisch. Doch niemand sollte sich täuschen, warnt der US-Journalist David Graham: Im Hintergrund verfolgen aggressive, ultrakonservative Kräfte konsequent ihren Plan für Amerika.
Die erste Amtszeit von Donald Trump war in den Augen von Amerikas Ultrakonservativen und Radikalen verloren, das soll sich bei der zweiten nicht wiederholen. Im "Project 2025" haben Trumps Unterstützer und Verbündete niedergeschrieben, wie sie die Vereinigten Staaten umbauen wollen: Das Land soll autoritärer und christlich-nationalistischer werden.
US-Journalist David Graham ist einer der besten Kenner des "Project 2025", er hat mit "Der Masterplan der Trump-Regierung" ein Buch darüber geschrieben. Im Interview mit t-online erklärt Graham, wer hinter "Project 2025" steckt, wie diese Leute vorgehen und wie weit ihre Pläne reichen.
t-online: Herr Graham, mit dem sogenannten "Project 2025" wollen ultrakonservative Kräfte die Vereinigten Staaten nach ihren Vorstellungen umbauen. Was für ein Vorhaben ist das?
David A. Graham: Tatsächlich ist "Project 2025" der Generalschlüssel zum Verständnis der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Es ist ein Plan, der 2022 und 2023 von der rechtskonservativen Denkfabrik Heritage Foundation und zahlreichen konservativen Vordenkern ausgearbeitet wurde, um ihn dem nächsten republikanischen Präsidenten zu präsentieren. Er umfasst drei große Teile: Erstens finden wir politische Maßnahmen, zweitens eine detaillierte Ausarbeitung zu deren Umsetzung und schließlich eine Datenbank mit Personen, die in diesem Sinne in der Verwaltung arbeiten könnten. Das hat sich insgesamt als nützliche Blaupause dafür erwiesen, wie die Trump-Administration in ihren ersten Monaten vorgegangen ist.
In Ihrem Buch "Der Masterplan der Trump-Regierung" sezieren Sie dieses Vorhaben. Welche Rolle spielt dabei der Versuch, das demokratische Kontrollsystem der "Checks and Balances" auszuhebeln?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Autoren sagen, dass allein der Präsident Autorität über die Exekutive haben soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie das Verwaltungspersonal stark reduzieren: So wollen sie dann den Laden übernehmen, um es salopp auszudrücken. Besonders radikal ausgeprägt sind die fundamentalistischen christlichen Prinzipien, die in "Project 2025" eingeflossen sind: Abtreibung soll strengstens verboten, Sex streng reguliert werden. Öffentliche Schulen sollen im Vergleich zu religiösen Schulen geschwächt werden.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Kandidaten fürs Weiße Haus, ihre Parteien und Organisationen in ihrem Umfeld auf eine anstehende Machtübernahme vorbereiten. Was ist beim "Project 2025" anders?
Das ist richtig. Aber es unterscheidet sich von früheren Blaupausen durch drei Faktoren: Zunächst ist das schiere Ausmaß der Beteiligten, die am "Project 2025 mitgearbeitet" haben, erstaunlich. Es handelte sich um Dutzende Organisationen und rund 70 Mitwirkende. Zweitens umfasst "Project 2025" die Erstellung einer Datenbank für potenzielle Arbeitnehmer, die dessen Ziele umsetzen helfen sollen. Dazu kommt, drittens, noch der ungeheure Ehrgeiz, der daraus spricht: "Project 2025" ist nicht nur eine Liste von Maßnahmen, sondern ein detaillierter Ansatz, wie diese mittels sehr weitreichender Schritte umgesetzt werden sollen. Diese Leute meinen es todernst.
Zur Person
David A. Graham ist amerikanischer Journalist und Politikredakteur beim US-Magazin "The Atlantic" sowie Autor des Newsletters "Atlantic Daily". Graham erhielt für seine Berichterstattung über die Präsidentschaftswahlen 2020 den Toner Prize for Excellence in National Political Reporting. Gerade erschien sein Buch "Der Masterplan der Trump-Regierung: Project 2025. Wie ein radikales Netzwerk in Amerika die Macht übernimmt" im Verlag S. Fischer.
Wer sind die zentralen Figuren?
Zunächst ist da Kevin D. Roberts als Präsident der Heritage Foundation zu nennen, der als die treibende Kraft des "Project 2025" gilt. Roberts berief dann wiederum Paul Dans als dessen Leiter. Dans war bereits Mitglied von Trumps erster Administration und brachte für "Project 2025" die richtigen Leute zusammen. Russell Vought wiederum war die treibende intellektuelle Kraft. Dans und Vought teilen die Überzeugung, dass bereits die Auswahl des Personals entscheidend sei. Wie will man einen Staat ohne die entsprechenden Leute umbauen?
Vought hat dazu die richtige Position inne: In Trumps erster Amtszeit war er bereits Chef des Office of Management and Budget (OMB) (Amt für Verwaltung und Haushaltswesen), nun hat Trump ihn erneut auf diese Position gehievt.
Das OMB hat einen langweiligen Namen, aber es ist von Bedeutung. Denn es erstellt nicht nur den Haushalt, sondern überwacht das Tagesgeschäft der Exekutive. Man sollte sich auch nicht von Russell Voughts sanfter Erscheinung täuschen lassen, dahinter verbirgt sich eine radikale Weltanschauung. Vought weiß aufgrund seiner Erfahrung sehr gut, wie man die Verwaltung von innen heraus zerlegen kann.
"Project 2025" ist und war allerdings nie ein Geheimprojekt. Die Initiatoren haben es lange vor der vergangenen Präsidentschaftswahl online gestellt. Das war doch kostenlose Wahlkampfmunition für die Demokraten. Welcher Sinn steckte dahinter?
Ich vermute, dass sie ihren Einfluss dadurch stärken und Konkurrenten im konservativen Bereich einen Schritt voraus sein wollten. So versuchten sie, den Wahlkampf früh in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.
Jetzt sind diese Leute tatsächlich in der Lage, zumindest Teile ihres Planes in die Realität umzusetzen: Wie gehen sie vor?
Zentral ist der Angriff auf den öffentlichen Dienst. Diese Leute nutzen eine Reihe von Methoden, um den Staat zu schleifen: etwa Entlassungen, aber auch die Umwandlung von Beamtenstellen in politische Angestelltenverhältnisse. Generell soll die Exekutive mehr Macht über die Angestellten in den entsprechenden Behörden haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Übernahme und Etablierung unabhängiger Agenturen innerhalb der Exekutive. Deren Leiter werden zwar vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt, dann arbeiten sie mehr oder weniger unabhängig.
Elon Musk sollte für Donald Trump die sprichwörtliche Kettensäge beim "Abbau" der Bürokratie sein. Wie passt der superreiche Unternehmer da ins Bild?
Musks Arbeit für "DOGE", also die "Abteilung für Regierungseffizienz", ist ein Grund, warum "Project 2025" so weit fortgeschritten ist. Die Leute hinter "Project 2025" hatten sich sorgfältig überlegt, wie sie die Regierung auseinandernehmen könnten. Doch dann ist Musk wie mit einem Bulldozer hindurchgefahren: So schloss er das Bildungsministerium, griff USAID an und entließ massenweise Mitarbeiter der Exekutive. Ein anderer Grund für den Erfolg besteht darin, dass Leute generell viel Erfahrung in der Regierungsarbeit mitgebracht haben. Rund ein Viertel der Autoren des "Project 2025" hatte bereits in Trumps erster Administration mitgearbeitet.
Welche Rolle spielt Donald Trump für die Leute hinter "Project 2025"?
Trumps Wahlsieg hat sie ermutigt. Er ist eine Art Gefäß für ihre Ambitionen und gab diesen Leuten ein Gefühl dafür, was plötzlich alles möglich ist. Sie wissen genau, was Trump will. Die Themen Zölle und Migration sind ihm wichtig, er hat großes Interesse an Vergeltung. Da ist es entscheidend, das Justizministerium unter seine Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig sind Trump andere Bereiche egal, auf diesen Gebieten können die Anhänger von "Project 2025" schalten und walten. Vor allem wollen sie alte Fehler vermeiden.
Wie es sie in Trumps erster Amtszeit ihrer Meinung nach gab?
So ist es. Für diese Leute war Trump während seiner ersten Präsidentschaft nicht gescheitert, sondern er wurde angeblich sabotiert: Faule Angestellte, Karrieristen in der Bürokratie und "rückständige" Republikaner hätten Trump ausgebremst. So sieht die Gedankenwelt dieser Leute aus. So etwas soll nicht noch einmal passieren. Deswegen wollten sie sicherstellen, dass es einen Plan gibt und die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind, falls Trump zurückkehrt. So kam es dann ja auch.
Wie zentral ist für das "Project 2025" die Lüge vom Wahlbetrug im Jahr 2020?
Sie ist sehr wichtig. Sie rechtfertigt gewissermaßen die Machtübernahme. Wenn das System angeblich manipuliert ist, kann man radikale Schritte leichter begründen. Sie wollen das eigentlich unabhängige Justizministerium darauf ausrichten, politische Gegner und Wahlbetrug zu verfolgen, obwohl der kaum existiert.
Nun finden im November 2026 die Zwischenwahlen statt, die die Mehrheiten im bislang republikanisch dominierten Kongress ändern könnten. Somit handelt es sich doch um ein Spiel auf Zeit?
Die Demokraten werden ziemlich sicher das Repräsentantenhaus zurückgewinnen, aber wohl nicht den Senat. Davor werden auch Gerichte immer wieder Entlassungen rückgängig machen, insbesondere die von Musk initiierten. Aber selbst wenn Regierungsmitarbeiter wieder eingestellt werden, ist etwas verloren gegangen. Leuten wie Russell Vought ist zudem bewusst, dass der Umbau der Gesellschaft in ihrem Sinne viel länger als vier Jahre dauern wird. Es ist ein Plan, der weit über Trumps Präsidentschaft hinausgeht. Das macht es auch so ungeheuer bedrohlich.
Ist das Lager der Ultrakonservativen im Trump-Lager wirklich so geschlossen?
Tatsächlich ist das Ausmaß der Übereinkunft schon recht hoch, aber es gibt durchaus Dissens. Die Zölle sind ein gutes Beispiel dafür: Peter Navarro, Trumps Berater, plädiert etwa für Strafzölle. Der Leiter einer anderen konservativen Denkfabrik sagt hingegen, dass Zölle eine schlechte Idee sind, weil die Globalisierung das Leben der Amerikaner verbessert habe.
Gibt es Positionen, bei denen "Project 2025" und Donald Trump unterschiedlicher Auffassung sind?
Da ist die Ukraine ein gutes Beispiel. Die Autoren von "Project 2025" argumentieren, dass die USA die Ukraine weit stärker unterstützen müssen. Da unterscheiden sie sich sehr von der Auffassung eines Trump oder JD Vance. Die Leute hinter "Project 2025" sind zudem Russland gegenüber viel kritischer eingestellt.
Wie "weiß" ist "Project 2025"? Es gibt ja auch einige Autoren mit Migrationshintergrund.
Die bekanntesten Autoren sind meist weiße Männer. Ihre Politik bezeichnen sie als "farbenblind". Sie geben also vor, Minderheiten vollkommen ungeachtet ihrer Hautfarbe helfen zu wollen.
Konservative und Liberale geben hier ja vor, dasselbe Ziel zu haben: gleiche Chancen für alle. Die Konservativen streben nach radikaler Gleichbehandlung aller Gruppen. Liberale hingegen möchten diskriminierende Strukturen ausgleichen.
Ja, der Oberste Richter am Supreme Court, John Roberts, sagte mal: "Um mit der Diskriminierung aufzuhören, muss man aufhören, nach Hautfarbe zu unterscheiden." Aber das blendet jahrzehntelange Unterschiede bei Einkommen, Bildung und Chancen aus. Es gibt jetzt auch die Idee, dass Gesetze nicht mehr auf ihre Wirkung für Minderheiten überprüft werden sollen. Dieser sogenannte "disparate impact" soll abgeschafft werden. Dann können sich Minderheiten kaum noch juristisch wehren.
Das "Project 2025" stellt das hingegen als Gleichberechtigung aller Ethnien dar.
Ja, aber in der Praxis geht es darum, den Schutz von Minderheiten abzubauen. Sie werden sogar umgekehrt, indem man etwa Bürgerrechte nun auf Christen konzentriert. Die Gleichstellungsbehörde klagt nun gegen "Diskriminierung von Christen" statt gegen Rassismus oder Sexismus.
Besteht denn Hoffnung, dass der Oberste Gerichtshof den Plänen von "Project 2025" zumindest teilweise im Wege steht?
Kevin Roberts, Russell Vought, Paul Dans und die anderen Autoren von "Project 2025" sind überzeugt, dass der Oberste Gerichtshof ihnen helfen wird, wenn Klagen dort landen. Für sie sind die bestehenden Gesetze oft verfassungswidrig. Ihre Devise lautet: Wir brechen das Gesetz, folgerichtig steht unsere Sache dann vor dem Obersten Gerichtshof, aber wir haben nichts zu befürchten. Denn die mehrheitlich konservativen Richter werden uns schon recht geben.
Können Sie einen Eindruck geben, wie viele der Ziele von "Project 2025" unter Trump bereits umgesetzt sind?
Das habe ich tatsächlich versucht herauszufinden – vor allem für mein Buch. Aber es ist schwierig. Denn es gibt viele verschiedene Ziele, einige von ihnen sind weitreichend, während andere sehr spezifisch aussehen. Von den Durchführungsverordnungen, die wir in den ersten Wochen nach Trumps Amtsantritt gesehen haben, stammen etwa 75 Prozent direkt aus dem "Project 2025". Das lässt sich am Wortlaut nachvollziehen. Seitdem ist noch viel mehr passiert.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass "Project 2025" den einflussreichen, großen Tech-Unternehmen misstraut. Warum eigentlich? Trump unterhält doch auch enge Beziehungen zumindest zu manchen Tech-Konzernen.
Sie betrachten Big Tech aus mehreren Gründen mit Skepsis. Zum einen sehen sie eine zu große Nähe zu China. Apple und auch Elon Musk gelten als zu freundlich gegenüber China. Zudem wird die Tech-Branche als tendenziell liberal angesehen, auch wenn sich das gerade ändert. Konservative sorgen sich außerdem stark um die Wirkung von sozialen Medien auf Kinder. Und sie glauben, dass konservative Stimmen online unterdrückt werden. "Project 2025" will deshalb hart gegen Big Tech vorgehen. Sie sehen darin eine Bedrohung der Meinungsfreiheit.
Hat der Plan, den Präsidenten mit einer besonderen Machtfülle auszustatten, auch damit zu tun, dass China als Konkurrent gesehen wird und das autoritäre System dort als effizienter gilt? Demokratische Prozesse sind ja oft langsam.
Diese Argumentation hört man von ihnen nicht direkt. Klar ist China ein Thema, und sie wollen mehr Produktion in die USA zurückholen. Aber der Fokus liegt vor allem auf dem Thema Regulierung: Sie wollen weniger davon, wenn es die Wirtschaft ausbremst, aber mehr, wenn es darum geht, den eigenen Markt zu schützen. Das ist widersprüchlich.
Woher könnte Widerstand gegen die Ziele des "Project 2025" kommen? Bisher äußern sich vor allem sehr linke Politiker wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez kritisch.
Die Gerichte haben sich bisher als effektivster Widerstand erwiesen. Anders als von den "Project 25"-Leuten erwartet, kommt er sogar von Richtern, die Trump ernannt hat. Der Kongress hätte die Macht, Trump zu bremsen, nutzt sie aber nicht. Den Demokraten fehlen eine Führung, eine neue Vision und eine klare Botschaft. Aber sie wissen jetzt, dass sie mehr öffentliche Gegenwehr mobilisieren müssen, mit Protesten, die auf die unpopulären Maßnahmen aufmerksam machen.
Aber die Mehrheit der Amerikaner hat doch für Trump gestimmt und damit auch für diese lange bekannte radikale Agenda.
Vieles, was "Project 2025" will, die Sozialkürzungen, Entlassungen von Beamten, sind in Wahrheit sehr unpopulär. Die Republikaner im Kongress arbeiten daran, die Steuersenkungen zu verlängern. Das kommt zwar an. Aber gleichzeitig wollen sie Sozialleistungen wie Medicaid kürzen und die Staatsverschuldung erhöhen. Das kommt nicht gut an. Trotzdem: Solange die Demokraten bis zu den Zwischenwahlen keine Mehrheit im Kongress haben, hat Trump grundsätzlich freie Bahn.
Warum wollten Sie dieses Buch unbedingt schreiben?
Viele Menschen wussten zwar vor der Wahl, dass es das "Project 2025" gibt, viele aber nicht, wie detailliert und radikal es ist. Ich wollte zeigen, wer dahintersteht und wie es diese Trump-Regierung prägen wird. Selbst die Demokraten wurden davon überrascht, obwohl vieles ja längst öffentlich dokumentiert war.
Warum hat die Warnung vor dem "Project 2025" kaum durchgeschlagen?
Die Demokraten haben das im Wahlkampf als bloße Liste von Vorhaben dargestellt, aber nicht als den großen, radikalen Bruch. Die Leute reagieren aber nicht auf abstrakte Demokratie-Argumente. Viele glaubten auch nicht, dass Trump das wirklich alles umsetzt. Dazu haben Joe Bidens Alter und Führungsschwäche der Glaubwürdigkeit der Demokraten geschadet.
Welche Warnung würde bei den Wählern am ehesten durchdringen, selbst bei Trumps Anhängern?
Es geht um eine radikale Machtverschiebung weg vom Kongress und den Gerichten hin zum Präsidenten. Und um eine Rückkehr zu einer Gesellschaft mit weniger Freiheit für Frauen, Minderheiten und LGBTQ-Personen. Das "Project 2025" definiert Freiheit nicht mehr als "tun, was man will", sondern als "tun, was man soll". Viele Trump-Anhänger fürchten Machtmissbrauch durch die Eliten. Aber genau das ist "Project 2025".
Es wirkt paradox: Trump und das "Project 2025" fordern eine radikale Machtzentralisierung im Weißen Haus. Dabei misstrauen viele Amerikaner Washington. Ist ein "Superpräsident" überhaupt vermittelbar?
Genau deshalb handeln sie so schnell und setzen auf Dekrete. Eine Umfrage der Heritage Foundation von 2024 zeigte: Nur 14 Prozent der Wähler in den Swing States sehen "Project 2025" positiv. Aber die Anhänger glauben, dass es nötig ist, um das "wahre" Amerika zu bewahren.
Müssen die Wähler die wahren Auswirkungen immer erst direkt spüren?
So scheint es zu sein. Jetzt sinken Trumps Zustimmungswerte, weil konkrete Folgen sichtbar werden. Das "Project 2025" bietet zum Beispiel keine Lösung für die Inflation, angesichts der Zollpolitik womöglich sogar das Gegenteil. Dabei interessieren die hohen Preise die Leute am meisten.
Warum wählen Menschen gegen ihre eigenen Interessen?
Kulturelle Wut spielt eine große Rolle. Trump gibt den Leuten das Gefühl, dass er dieselben Eliten hasst wie sie, also Universitäten, Behörden und Politiker. Diese Wut wirkt oft stärker als die wirtschaftlichen Sorgen, zumindest, solange die wirtschaftlichen Schmerzen nicht zu groß werden.
In Europa gibt es ähnliche politische Entwicklungen wie in den USA. Was lässt sich tun, um nicht ebenso schlafwandelnd in einen Autoritarismus zu geraten?
Es ist entscheidend, dass demokratische Institutionen funktionieren. Sind Parlamente handlungsunfähig und Behörden unterfinanziert, wächst das Misstrauen und Populisten haben leichtes Spiel. Eine freie Presse ist ebenfalls zentral. In den USA, Ungarn oder der Türkei werden Medien systematisch angegriffen. Parlamente müssen also gestärkt werden. Das ist in einem Zweiparteiensystem wie den USA schwer, besonders wenn eine Partei sich vollkommen um eine einzelne Figur wie Trump dreht.
- Persönliches Gespräch mit David A. Graham via Videokonferenz