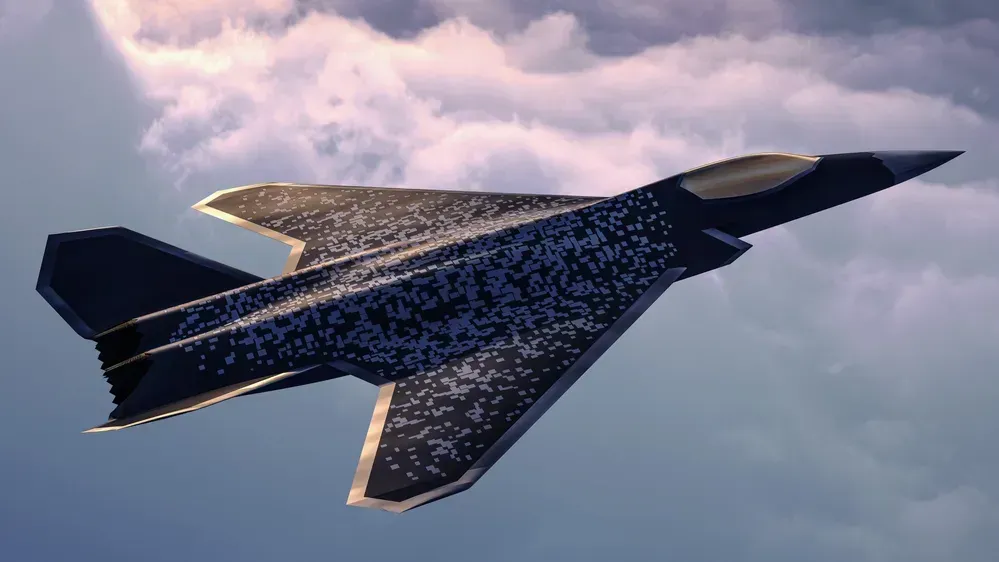Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Diskussion um Rente "Das ist historisch enttäuschend"


Mit Blick auf eine Rentenreform bleibt die neue Regierung vage. Zwei Gesetzesvorhaben wurden zuvor auf der Zielgeraden gestoppt. Ein Experte erklärt, warum sich die Politik so schwertut – und wo Deutschland dringend hinmüsste.
Dass die umlagefinanzierte gesetzliche Rente mit dem demografischen Wandel an ihre Grenzen stößt, ist gemeinhin bekannt: Ökonomen warnen seit Jahren davor. Und die Statistiken zeigen, dass längst nicht alle betrieblich und privat vorsorgen, um ihre Rentenlücke zu schließen. Wer von Alters wegen in Rente geht, erhielt 2023 im Schnitt 1.100 Euro. Und es könnte weniger werden.
Doch wenn es um die Reform der Rente geht, scheint eine parteiübergreifende, langfristige Lösung schwer: Mit Mütterrente und Frühstart-Rente setzt die schwarz-rote Koalition kleine Impulse, doch der große Wurf, also konkrete Reformvorhaben, bleibt aus (lesen Sie hier mehr dazu). Warum sich die Politik so schwertut und wo Deutschland dringend hinmüsste, erklärt der Finanzexperte Thomas Soltau im Interview mit t-online.
t-online: Herr Soltau, die Ampelkoalition hat es in den vergangenen drei Jahren nicht geschafft, bei der Rente nennenswerte Reformen anzustoßen – obwohl vieles geplant war, unter anderem das Generationenkapital. Wie bewerten Sie das?
Thomas Soltau: Das ist historisch enttäuschend. Schon in den 80er-Jahren hat Norbert Blüm plakatiert: "Die Rente ist sicher". Das macht man nicht, wenn sie es tatsächlich ist. Es war also längst bekannt, dass wir ein strukturelles Problem haben. Seither gab es mehrere Versuche, um die Rente zu sichern, etwa die Riester-Rente, die aber aus heutiger Sicht gescheitert ist. Wir geben jedes Jahr rund 3,5 Milliarden Euro an Steuern für das Riester-System aus – ohne dass es wirklich nachhaltige Wirkung zeigt. Die Einzigen, die davon profitieren, sind die Versicherungskonzerne.

Zur Person
Thomas Soltau ist Vorstand der Smartbroker AG – neben Trade Republic und Scalable Capital einer von Deutschlands bekanntesten Neo-Brokern. Von März 2022 bis zum Bruch der Ampel war der gelernte Bankkaufmann im Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums als Beirat tätig und diskutierte die Reform der Altersvorsorge in Deutschland auf hoher politischer Ebene mit.
Ein starker Vorwurf
Doch es ist so. Es ist dramatisch, dass wir Jahr für Jahr Zeit verschenken. Jede unterlassene Reform kostet uns nach hinten hinaus Milliarden. Dabei hätte die Ampelregierung die Chance gehabt zu handeln. Besonders bitter ist, dass ein Reformpaket schon auf der Zielgeraden war.
Sie sprechen vom Rentenpaket II, das unter anderem das Generationenkapital – also den Aufbau eines Aktienkapitals bei der gesetzlichen Rente – enthielt, und von der Reform der privaten Altersvorsorge.
Richtig. Zwei, drei Wochen später hätte das Ganze durchs Parlament gehen können. Stattdessen ist es auf der letzten Strecke gescheitert. Ich bin maßlos enttäuscht.
Wird es denn der Regierung unter Kanzler Merz gelingen, einen großen Wurf in der Rentenpolitik zu landen?
Ich hoffe es, bleibe aber skeptisch. Mich hat eine Aussage von Lars Klingbeil irritiert: Er sagte, das Finanzministerium solle künftig als "Investitionsministerium" verstanden werden. Da bekomme ich Gänsehaut.
Was irritiert Sie?
Der Staat muss gewisse Zukunftsbereiche fördern – Digitalisierung, Bildung und die Infrastruktur dazu bereitstellen. Auch Verteidigung gehört dazu. Klingbeil meint oft genug nur kurzfristige, teils dringende Investitionen. Und oft auch Wahlgeschenke. Gemeint ist sicherlich nicht, dass Kapital in einen Kapitalstock investiert wird, um eine Basis für die Zukunft zu legen.
Und was verstehen Sie unter Investitionen?
Für mich zählt die Rente auch zu den Zukunftsinvestitionen. Ich erwarte vom Staat, dass er den Kapitalmarkt stärkt – durch eigene Investitionen und durch Förderung für private Vorsorge. Dass wir ein massives Problem in der gesetzlichen Rente haben, ist längst bekannt. Es braucht den Kapitalstock, um mittelfristig gegenzusteuern.
Warum tut sich Deutschland denn beim Thema Altersvorsorge so schwer?
Das zentrale Problem ist die fehlende Ehrlichkeit in der Kommunikation.
Erklären Sie das bitte.
Die Politik hat bei der Einführung von Riester Anfang der 2000er durchaus signalisiert, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Aber sie hat es nie so klar gesagt, wie es nötig gewesen wäre: 'Ihr müsst das machen, ihr habt keine Wahl.' Das Thema ist sozialer Sprengstoff.
Immerhin sprechen wir von Millionen Menschen, die eine sichere Rente erwarten.
Aber viele Deutsche haben gar nicht die Möglichkeit, privat vorzusorgen. Ihnen zu sagen, dass sie im Alter arm sein könnten, obwohl sie Jahrzehnte in die gesetzliche Rente einzahlen, ist heikel. Manche haben das Problem bereits verstanden – sie wissen, dass die Rente nicht sicher ist. Aber sie wissen nicht, wie sie selbst handeln sollen. Es fehlt an Aufklärung und an einfachen, vertrauenswürdigen Produkten.
Woran scheitern konkrete Reformen aus Ihrer Sicht am meisten?
Oft an politischen Blockaden. Es gibt viele gute Ideen – aber sobald eine Partei etwas vorschlägt, blockieren die anderen aus Prinzip oder weil sie Rücksicht auf bestimmte Wählergruppen nehmen müssen. Die CDU hat in der Vergangenheit lieber Rentengeschenke verteilt, statt echte Reformen anzustoßen. Bei der SPD ist das ähnlich. Man will den Status quo sichern, um keine Wähler zu verlieren – besonders eben ältere Menschen. Dazu kommt der enorme Einfluss der Versicherungslobby.
Wie meinen Sie das?
Sie hat jahrelang mit Produkten wie Riester sehr gut verdient. Als beim Altersvorsorge-Depot plötzlich nicht mehr Versicherungen, sondern Banken und Broker die Hauptrolle gespielt hätten, gab es massiven Widerstand. Christian Lindner als Finanzminister hat sich damals klar positioniert und gesagt: Die Versicherungen haben genug verdient, jetzt ist Schluss. Das war mutig – aber leider hat es am Ende nicht gereicht.
Ist der Generationenvertrag überhaupt noch zu retten?
In seiner jetzigen Form und ohne grundlegende Reform – nein.
Das ist ein starkes Statement.
Die demografischen Fakten sprechen gegen ihn. Immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Rentner finanzieren. Das kann nicht funktionieren. Schon heute haben wir ein Verhältnis von etwa 2 zu 1 – also zwei Beitragszahler auf einen Rentner. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und in den kommenden Jahren wird sich das Problem durch die Babyboomer dramatisch verschärfen. Wir müssten ehrlich sagen: Dieses System ohne Eigenvorsorge und Kapitalmärkte reicht nicht mehr.
Und warum kommt keine breite gesellschaftliche Debatte über die Rentenfrage auf?
Weil sie unbequem ist. Solange keine Lösung in Sicht ist, will man die Leute nicht unnötig beunruhigen. Um ein Beispiel zu nennen.
Gerne.
Die digitale Rentenübersicht ist technisch ein großer Fortschritt. Jeder Bürger kann dort seine Rentenansprüche einsehen – inklusive Lücken. Aber kaum jemand nutzt sie. Warum? Weil die Politik zu wenig darüber informiert. Aus gutem Grund: Sie kann keine Antwort auf die Frage geben, was man tun soll, wenn man eine riesige Versorgungslücke sieht. Die Lösung fehlt. Und solange das so bleibt, wird die Politik auch keine breite Aufklärungskampagne starten. Doch die braucht es, da unter anderem aufgrund der gescheiterten Riester-Rente viel Unsicherheit bei den Menschen herrscht.
Was wäre denn Ihr konkreter Wunsch an die Politik?
Es braucht einen parteiübergreifenden Konsens. Ein gemeinsames, tragfähiges Modell, das über Legislaturperioden hinweg Bestand hat. Es reicht nicht, wenn einzelne Ministerien Vorstöße wagen, die dann beim nächsten Koalitionswechsel wieder verschwinden. Wir brauchen eine Reform, die generationenübergreifend funktioniert. Ehrlich, einfach, verständlich. Ohne unnötige Komplexität, mit klarer Förderung und – ganz wichtig – mit einem Bildungsangebot, das die Menschen befähigt, solche Produkte auch zu nutzen.
Noch einmal zurück zur Merz-Regierung. Ein konkreter Reformvorschlag ist ja die sogenannte Frühstart-Rente. Was halten Sie davon?
Die Frühstart-Rente ist ein interessanter Ansatz. Sie setzt früh an, bei Kindern – das zwingt auch die Eltern, sich mit Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Wenn man im frühen Kindesalter beginnt, einen Kapitalstock aufzubauen, wird das langfristig helfen, Altersarmut zu verhindern. Es ist der erste politische Vorschlag, der Wertpapiere explizit fördert und eine sehr reale Umsetzungschance hat – und das ist bemerkenswert. Aber das allein löst die Rentenkrise nicht. Doch es ist ein Anfang. Ein echter struktureller Wandel wird aber nicht daraus entstehen – dazu ist der Ansatz zu klein. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
- Lesen Sie auch: So viel Geld bringt die Frühstart-Rente fürs Alter
Wann ist mit einem Gesetz zur Frühstart-Rente zu rechnen?
Im Koalitionsvertrag steht, dass das Ganze am 1. Januar 2026 starten soll. Realistisch betrachtet müsste das Gesetz im Juli oder August 2025 eingebracht werden, damit auch Anbieter rechtzeitig die darauf aufbauenden Produkte schaffen können. Ob das klappt, ist offen – es ist sportlich. Vor allem, weil es noch Dissens zwischen den Parteien gibt, etwa bei der konkreten Ausgestaltung. Vermutlich wird man sich an das Konzept des Altersvorsorge-Depots anlehnen.
Bei dem sollten Sparer und Anleger Geld vom Staat dazubekommen, wenn sie eben fürs Alter vorsorgen.
Dieses wurde ja bereits im Bundesfinanzministerium vorbereitet. Das größere Problem liegt jedoch in der Umsetzung. Technisch gesehen muss das Geld über das Bundeszentralamt für Steuern an die Broker, Banken und Versicherungen verteilt werden. Dafür müssten diese Anbieter an das Amt angebunden werden – was bisher nicht der Fall ist. Und: Es fehlen vermutlich Personal und Infrastruktur.
Das klingt nach einem immensen Verwaltungsaufwand.
Genau. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt. Es ist gut, dass wir überhaupt endlich über solche Modelle sprechen. Aber ich fürchte, der Verwaltungsaufwand für 10 Euro monatlich ist am Ende größer als der Nutzen. Es gibt alternative Vorschläge – zum Beispiel, bei Geburt einmalig 3.000 Euro anzulegen. Das wäre vermutlich effizienter und administrativ deutlich einfacher. Solche Einmalzahlungen sind aber im Bundeshaushalt schwer unterzubringen. Wir laufen bei der Frühstart-Rente in ein ähnliches bürokratisches Konstrukt wie bei der Riester-Rente hinein. Allerdings immerhin mit mehr Freiheiten für den Kunden, was vermutlich den Erfolg der Geldanlage realistischer macht.
Wird es denn eine grundlegende Riester-Reform geben?
Es gibt Signale aus der SPD und CDU, dass man Riester neu aufsetzen will – das ist wichtig und überfällig. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Riester-Rente durch ein neues Anlageprodukt abgelöst werden soll. Immerhin steht dort "Anlageprodukt" und nicht "Versicherungsprodukt". Das lässt Spielraum. Aber es zeigt auch: Die Diskussion ist bei den Parteien noch nicht abgeschlossen.
Was wäre ein sinnvoller Weg?
Eben das Altersvorsorge-Depot, wie es die FDP vorgeschlagen hat. Es hätte bestehende Verträge nicht berührt, wäre kostengünstig gewesen und hätte viele Interessen berücksichtigt. Nur die Zulagenverwaltung und Besteuerungsstruktur war, wie angesprochen, deutlich zu komplex – da hätte man entschlacken müssen. Andere Länder, wie Großbritannien oder Frankreich, machen es einfacher.
Können Sie ein Beispiel nennen?
In Frankreich etwa kann man über die Jahre bis zu 150.000 Euro bzw. 225.000 Euro anlegen, – je nach Anlageform. Man muss mindestens fünf Jahre dabeibleiben und erhält dann Steuerfreiheit auf Kapitalerträge bei fast allen Investitionen – ohne Zulagen, daher auch ohne komplizierte Zulagenstellen oder besondere Antragsverfahren. Das überzeugt viele Menschen, weil es nachvollziehbar ist. In Deutschland hingegen diskutierten wir zuletzt über zusätzliche Steuerbelastungen auf Kapitalerträge. Das schreckt ab. Wenn führende Politiker Aktien noch immer als "Lottospiel" diffamieren, untergräbt dies das Vertrauen massiv. Oder wenn der Finanzminister sagt, er lege sein Geld bei seiner Hausbank in der Lüneburger Heide an. Dabei wissen wir längst: Ohne Kapitalmarkt wird es nicht funktionieren.
Herr Soltau, vielen Dank für das Interview.
- Gespräch mit Thomas Soltau