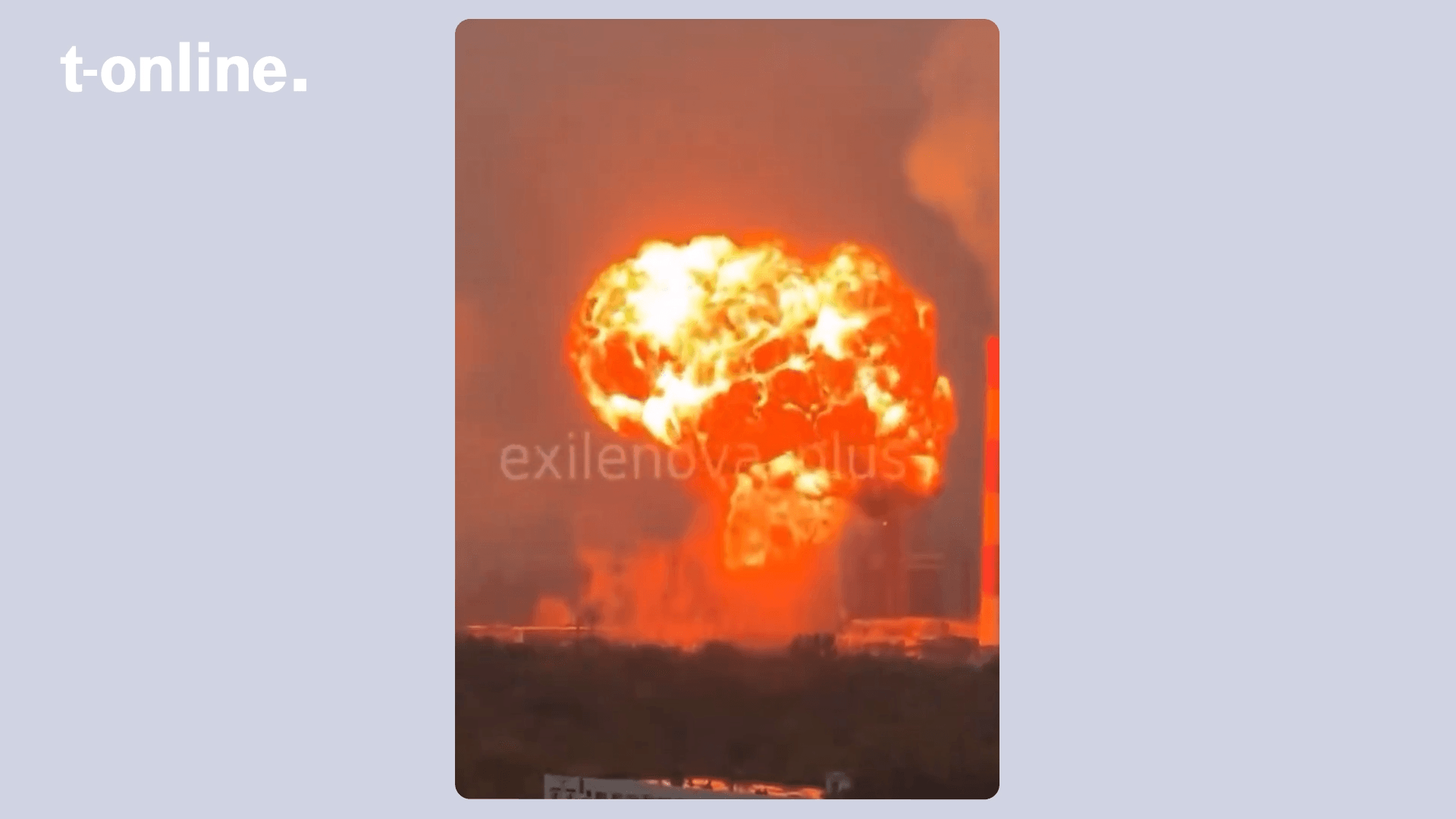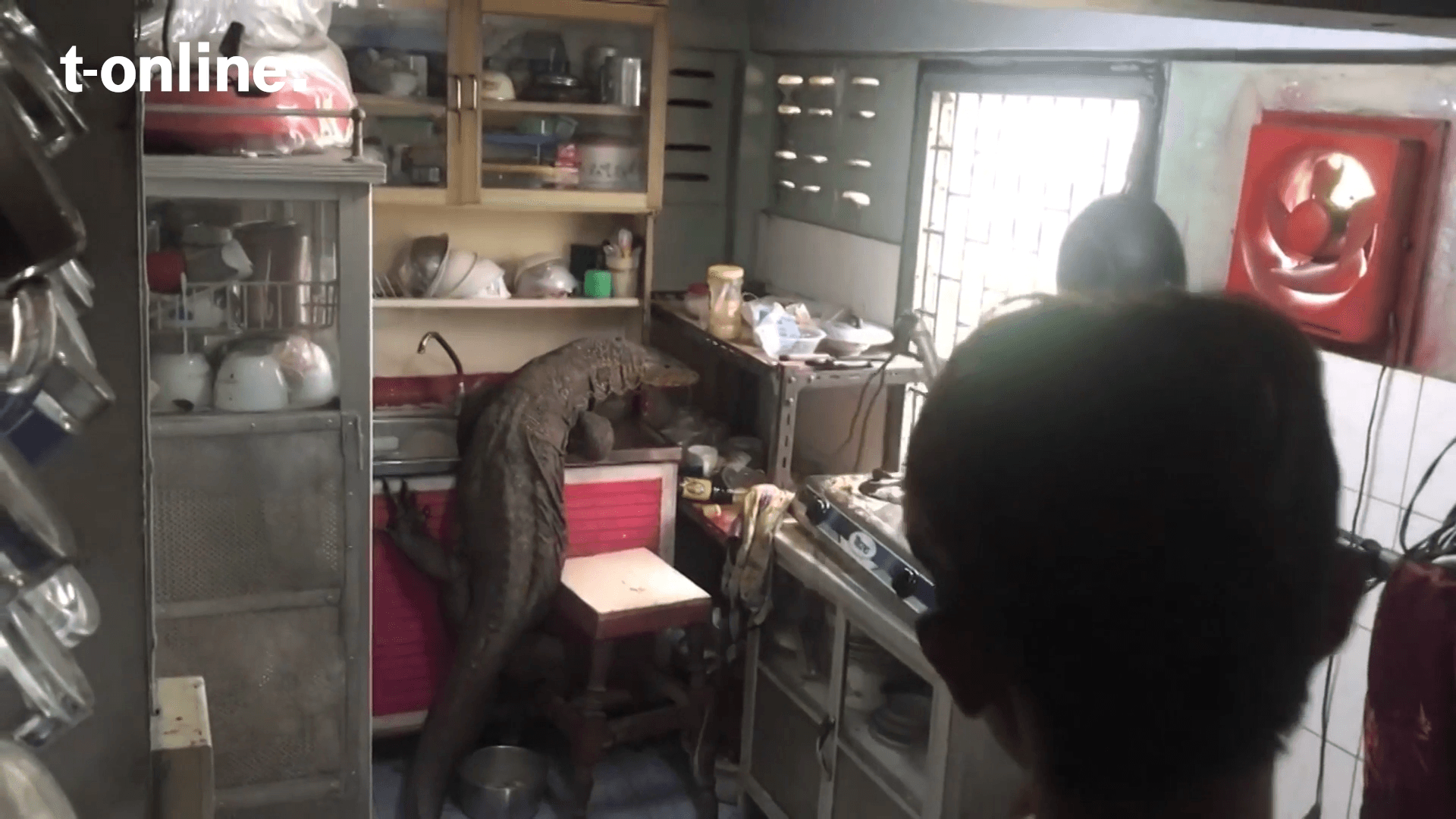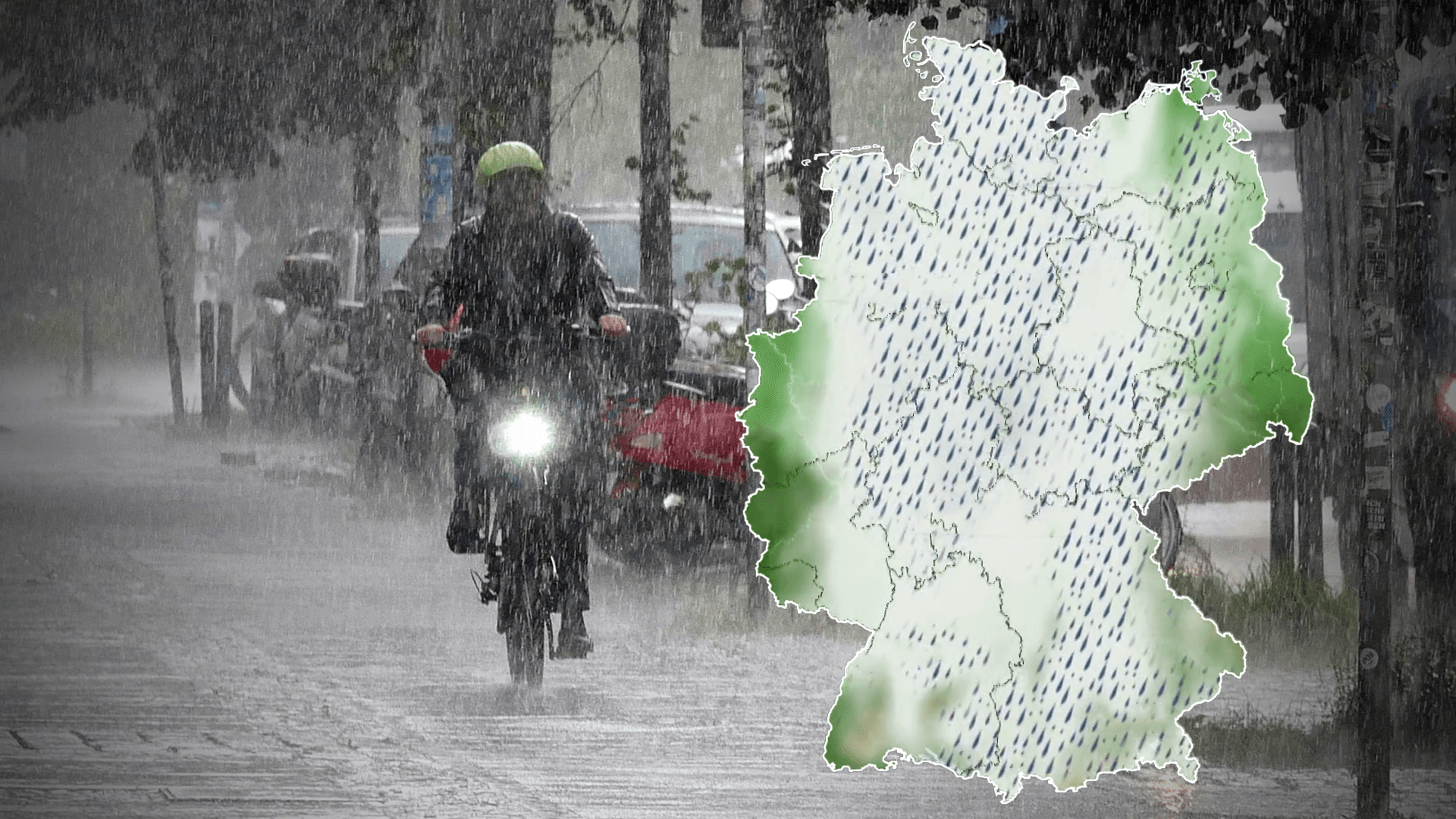Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Chef des Handelsverbands "In vielen Innenstädten sieht es deshalb düster aus"


Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE, ist überzeugt von der Zukunft des Einzelhandels. Doch hohe Kosten und chinesische Billigimporte treiben die Branche in die Enge. Was es laut ihm nun braucht.
Samstags durch die Innenstadt schlendern, in Schaufenster blicken, Tüten tragen, zwischendurch ein Kaffee in der Sonne – für viele gehörte das lange zum festen Ritual. Doch diese Szenen werden seltener. Immer mehr Menschen bestellen lieber online – bequem, schnell, günstig.
Für den Einzelhandel bedeutet das: schrumpfende Margen, sinkende Besucherzahlen, geschlossene Filialen. Dabei ist die Branche ein Schwergewicht – mit Millionen Beschäftigten und einer zentralen Rolle für lebendige Innenstädte. Doch wie steht es aktuell wirklich um den deutschen Einzelhandel?
- Einzelhandel in der Krise: "Es ist ein Kampf ums Überleben"
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, über Billigplattformen wie Temu und Shein, die Sorge vor einem Weihnachtsgeschäft in der Krise – und warum er trotzdem überzeugt ist, dass Shoppen vor Ort eine Zukunft hat.
t-online: Herr Genth, wann waren Sie das letzte Mal im Laden shoppen?
Stefan Genth: Erst gestern, bei mir zu Hause ums Eck, ein paar Sachen für den Kühlschrank.
Und abgesehen von Lebensmitteln?
Vergangene Woche! Bei mir ist es leider immer eine Zeitfrage.
Damit sind Sie nicht allein. Viele Verbraucher setzen mittlerweile lieber aufs Onlineshopping, auch weil es schneller geht und unkomplizierter ist. Daher die Frage: Wie geht es dem Einzelhandel in Deutschland?
Kurz gesagt: nicht gut. Wirklich nicht gut. Die Kosten steigen unaufhaltsam und es gibt momentan keine Entspannung. Gleichzeitig ist die Konsumnachfrage in Deutschland noch nicht wirklich angesprungen. Die Leute sind zurückhaltend. Sparen ist angesagt, nicht konsumieren. Eigentlich haben wir nach wie vor eine gute Situation mit relativ geringer Arbeitslosigkeit. Doch die Stimmungslage ist weiter schlecht.
Wie wirkt sich das aus?
Wir gehen für dieses gesamte Jahr nur von maximal zwei Prozent Umsatzplus aus. Real ist das wahrscheinlich ein Nullsummenspiel oder ein minimales Wachstum von einem halben Prozent. Man sieht: Seit Corona gibt es eher eine Seitwärtsbewegung, teilweise gar eine Rezession. Das ist wirklich dramatisch.
Dieser Rückgang dauert schon länger an. In den vergangenen zehn Jahren haben knapp 20 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte zugemacht. Wo sehen Sie den Einzelhandel in zehn Jahren?
Ich sehe ihn weiterhin als eine der prägenden Branchen – digital und stationär. Die Schließungen betrafen nur in wenigen Fällen ganze Unternehmen, meist ging es um einzelne Standorte. Vor allem im ländlichen Raum und in kleinen Städten wurden Filialen aufgegeben. Corona hat das beschleunigt, sodass die Filialnetze ausgedünnt wurden. Aber der Einzelhandel bleibt eine tragende Branche: über drei Millionen Beschäftigte, 300.000 Unternehmen, 670 Milliarden Euro Umsatz.
Wird die Zahl der Standorte weiter sinken?
Ja, es werden weniger Geschäfte. Wir haben in den vergangenen Jahren eine massive Veränderung im Mittelstand gesehen, es läuft ein klarer Konzentrationsprozess. Ein Parfümeriehändler, der früher zwei, drei Filialen hatte, betreibt heute eher 10 oder 15. Das ermöglicht zwar Skaleneffekte, aber bei sinkender Konsumnachfrage müssen unrentable Filialen dicht machen. In vielen Innenstädten sieht es deshalb düster aus.
Wegen hoher Mieten?
Ja, das ist ein Faktor. In Top-Lagen wurden die Höchstmieten teils deutlich überschritten. Für Investoren ist es manchmal einfacher, eine Immobilie fünf Jahre leer stehenzulassen, als schnell zu vermieten und die Miete zu senken – weil das eine Neubewertung der Immobilie nach sich ziehen würde.
Abgesehen von lokalen Faktoren: Welche Branchen laufen besser, welche haben es schwer?
Hausgeräte und Elektronik sind stabil, ebenso Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Schwieriger ist es bei langlebigen Gütern wie Möbeln: Da halten sich Kunden aktuell zurück. Schwer haben es auch typische Innenstadtbranchen wie Schuhe, Textilien und Bekleidung. Hier sehen wir eine starke Zurückhaltung. Dennoch sage ich: Der stationäre Handel hat eine Zukunft.
Das müssen Sie als HDE-Chef auch sagen.
Ich bin auch davon überzeugt. Die Innenstadt wird auch morgen funktionieren – wenn die Ansprüche der Kunden erfüllt werden. Junge Menschen wollen sich analog treffen, nicht nur digital. Shoppen, Gastronomie, Kultur und Freizeit – das alles gehört für sie zusammen.

Zur Person
Stefan Genth (geboren 1963) ist seit 2007 Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), dem Spitzenverband des Einzelhandels mit rund 100.000 Mitgliedsunternehmen. Genth ist im europäischen Handelsverband EuroCommerce aktiv und Mitglied im Kuratorium des Instituts der deutschen Wirtschaft.
Gleichzeitig haben Sie den Textilbereich als besonders problematisch beschrieben. Jetzt drängen Billigprodukte aus China in den Markt, die es online extrem günstig gibt. Was nun?
Wir brauchen Zölle gegen chinesische Billigimporte nach dem Vorbild der USA. Wir sehen einen enormen Preisdruck: etwa 400.000 Pakete kommen täglich aus China. Es ist bereits entschieden, dass die Zollfreigrenze [von 150 Euro, Anm. d. Red.] in Europa gestrichen wird, aber es muss schneller gehen. Nicht erst 2028, sondern bereits 2026. Temu machte zuletzt etwa drei Milliarden Euro Jahresumsatz allein in Deutschland – eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. In den USA wurde die Zollfreigrenze gestrichen und eine Bearbeitungsgebühr eingeführt. Die Folge: Die Temu-App gibt es dort nicht mehr. Das kann auch Teil der Lösung in Europa sein.

Etwa 400.000 Pakete kommen täglich aus China.
HDE-CHef Stefan Genth
Also Apps wie Temu und Shein in Europa abschalten?
Nach europäischem Recht ist das nicht einfach, aber ja, notfalls muss man Temu und Shein den Stecker ziehen, bis diese Plattformen nachweisen, dass sie sauber arbeiten. Unsere Händler erfüllen hohe Standards und haften für alles, was sie verkaufen. Bei Direktimporten aus Drittstaaten gibt es keine effektive Haftung. Diese Wettbewerbsverzerrung müssen wir dringend abstellen. Die Verbraucherzentralen und Stiftung Warentest weisen ebenfalls darauf hin, dass viele Produkte, die direkt aus China an den Kunden gehen, schlicht Schrott sind und hier gar nicht verkauft werden dürfen. Neben der Streichung der Zollfreigrenze benötigen wir ein vollständig digitalisiertes Zollverfahren.
Erklären Sie das bitte.
Jedes Paket müsste mit einer einheitlichen Identifikationsnummer registriert werden, so wie es umgekehrt der Fall ist, wenn man nach China exportiert. Dann könnten die Zollbehörden gezielter kontrollieren. Ein Bearbeitungsentgelt von zwei Euro pro Paket, wie es in Europa diskutiert wird, ist allein nicht ausreichend.
Was braucht der Handel noch, damit es der Branche besser geht?
Ganz klar: Wir erwarten, dass die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß gesenkt wird. Das ist im Koalitionsvertrag so festgehalten worden, und die Unternehmen haben sich darauf verlassen. Es geht dabei nicht nur um die absolute Entlastung – im Handel wären das etwa 700 Millionen Euro –, sondern auch um Vertrauen. Die Senkung der Stromsteuer war über Jahre Thema, und die Erwartungshaltung daher riesig.
Was bedeutet das für den Handel?
Wir sind einer der größten Energieverbraucher in Deutschland – mit 300.000 Standorten. Gleichzeitig erzeugen wir auch selbst viel Energie: Photovoltaik auf Dächern von Supermärkten, Baumärkten und Möbelhäusern ist heute Standard. Aber es dauert teilweise mehr als ein Jahr, bis neue Anlagen ans Netz angeschlossen werden. Manche Unternehmen haben Planungen zurückgestellt, weil die Netzbetreiber nicht hinterherkommen. Wir haben mehr als 800 Verteilnetzbetreiber in Deutschland – das ist zu kleinteilig. Die Verfahren dauern zu lange. Netzkapazitäten fehlen, um neue Photovoltaikanlagen oder Ladeinfrastruktur schnell zu integrieren. Das sollte die Bundesregierung radikal vereinfachen.
Lassen Sie uns auf den Mindestlohn zu sprechen kommen. Er soll in den nächsten zwei Jahren in zwei Stufen auf 14,60 Euro steigen. Wird das für den Einzelhandel ein Problem?
Vorweg: Wir sind keine klassische Niedriglohnbranche. Helfertätigkeiten werden im Durchschnitt schon jetzt mit 16,44 Euro bezahlt – weit über dem aktuellen Mindestlohn. Wir sagen aber klar: Der Staat sollte sich aus der Lohnfestsetzung heraushalten. Die Mindestlohnkommission war ohnehin unter enormem politischen Druck, weil die 15 Euro von einigen Amtsträgern und Parteipolitikern gesetzt waren. Das ist der falsche Weg.
Wieso?
Grundsätzlich darf die Lohnfindung nicht politisiert und Spielball des Wahlkampfs werden, das wird sonst ein Überbietungswettbewerb. Höhere Arbeitskosten wirken sich aus: Viele Unternehmen werden Aushilfsjobs abbauen. Wir haben mehr als 800.000 Minijobber im Handel – Schüler, Studenten, Rentner, Aushilfen. Diese Jobs werden bei steigenden Lohnkosten zurückgefahren. Der Mindestlohn sollte sich an der Produktivität orientieren. Bei 15 Euro sprechen wir von sieben Milliarden Euro zusätzlicher Lohnkosten im Handel – elf Prozent obendrauf. Selbst die Stufen 13,90 Euro und 14,60 Euro bedeuten Mehrkosten von drei bis vier Milliarden.

Wir sind keine klassische Niedriglohnbranche.
HDE-Chef Stefan Genth
Sie haben eben von offenen Stellen gesprochen. Wenn der Mindestlohn steigt, könnte das nicht helfen, diese zu besetzen?
So einfach ist es leider nicht. Wir haben 122.000 offene Stellen, besonders in Service und Logistik – Regale einräumen, Kassen, Lager. Viele dieser Tätigkeiten können nicht sofort durch Arbeitslose aus anderen Branchen besetzt werden.
Im Einzelhandel arbeiten viele in Teilzeit. Könnten Sie nicht da ansetzen und Mitarbeiter zu mehr Arbeit bewegen?
Wir haben traditionell eine hohe Teilzeitquote und einen großen Frauenanteil. Viele Mitarbeitende würden gern mehr Stunden arbeiten, können es aber nicht, weil es an Kinderbetreuung fehlt – besonders nachmittags und an Wochenenden. Samstag ist der wichtigste Einkaufstag im stationären Handel. Wenn Kitas dann geschlossen sind, können viele Eltern nicht arbeiten. Wir fordern seit Jahren mehr und flexiblere Betreuungsmöglichkeiten. Zwei Teilzeitkräfte sind teurer als eine Vollzeitkraft, deshalb würden auch die Unternehmen profitieren, wenn mehr Mitarbeitende aufstocken könnten.
- Streit über Arbeitszeiten: Droht jetzt das Ende des Achtstundentags?
- Teilzeit und Frührente: Reiche fordert "mehr und längere Arbeit" von Deutschen
Was konkret fordern Sie?
Mehr Kita-Betreuungsplätze, flexiblere Öffnungszeiten, auch am Wochenende. Außerdem sollte die Steuerklassenkombination 3 und 5 abgeschafft werden. Heute ist es oft so, dass die Frau in Steuerklasse 5 weniger Netto vom Brutto hat. Das ist ein falsches Signal. Auch wegen des Personalmangels sehen wir einen Trend zur Automatisierung: Self-Scanning-Kassen nehmen zu. Bei Marks & Spencer in London gibt es zum Beispiel nur noch Selbstbedienungskassen. Das wird auch bei uns mehr werden.
Es gibt aber die Sorge, dass Self-Scanning-Kassen den Ladendiebstahl fördern.
Diesen Zusammenhang können wir nicht bestätigen. Einen belegbaren Zusammenhang zwischen Self-Scanning und Diebstahl gibt es nicht. In der Regel sind Mitarbeitende an den Kassen, die helfen und dabei auch kontrollieren. Das eigentliche Problem sind organisierte Banden und zunehmend aggressive Einzeltäter. Der Schaden durch Ladendiebstahl lag 2024 bei drei Milliarden Euro – 20 Prozent mehr als 2022.
Woran liegt dieser starke Anstieg?
Zum einen gibt es hochprofessionelle Bandenkriminalität. Tätergruppen fahren gezielt durch Innenstädte, stehlen hochwertige Ware – Parfüm, Schuhe, Elektronik – und verkaufen sie auf dem Graumarkt. Zum anderen nehmen aggressive Einzeltäter zu, die Mitarbeitende angreifen, wenn sie erwischt werden. Außerdem liegt es auch daran, dass zu viele Verfahren eingestellt werden. Händler erstatten Anzeige, und die Staatsanwaltschaften stellen anschließend aus Effizienzgründen ein. In der Konsequenz melden viele Händler frustriert viele Ladendiebstähle nicht mehr bei der Polizei. Deshalb ist die Dunkelziffer extrem hoch: 98 Prozent der Diebstähle werden nicht angezeigt.
Wie gehen die Händler mit der Diebstahlwelle um?
Sie investieren massiv in Prävention: Warensicherungen, Videoüberwachung, Schulungen für Mitarbeitende und zusätzliches Sicherheitspersonal. In Innenstädten organisieren Händler teilweise gemeinsame Sicherheitsdienste, die mit Polizei und Ordnungsamt kooperieren. Das kostet Geld – 1,5 Milliarden im vergangenen Jahr, die am Ende erwirtschaftet werden müssen. Und es führt dazu, dass immer mehr Waren weggeschlossen werden. Ich fürchte Zustände wie in den USA, wo fast alles hinter Glas liegt. Das ist ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber allen Kunden – obwohl über 90 Prozent ehrlich sind. Das ist schade, aber lässt sich kaum vermeiden. Der Staat muss härter durchgreifen. Wir fordern klare gesetzliche Änderungen: Staatsanwaltschaften dürfen Verfahren nicht massenhaft einstellen. Die personelle und technische Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte muss deutlich verbessert werden.

Ich fürchte Zustände wie in den USA, wo fast alles hinter Glas liegt.
HDE-CHef Stefan Genth
Für Kunden ist es noch in weiter Ferne, doch die Händler und Produzenten treffen schon bald Vorbereitungen fürs Weihnachtsgeschäft. Was erwarten Sie dieses Jahr?
Wir hoffen, dass bei den Verbrauchern mehr Zuversicht und Vertrauen ankommt. Die neue Bundesregierung ist noch keine 100 Tage im Amt, hat aber viele Themen auf dem Tisch – Energiepolitik, Stromsteuer, Netzgebühren. Wir erwarten, dass Maßnahmen beschlossen werden, die den Menschen Sicherheit geben. Es mangelt nicht an Einkommen und Vermögen. 70 bis 80 Prozent der Haushalte haben eigentlich genug, um zu konsumieren. Wenn die neue Bundesregierung Vertrauen aufbaut, stehen die Chancen gut, dass das Weihnachtsgeschäft besser läuft als vergangenes Jahr. Wir haben 2025 noch lange nicht abgeschrieben.
Herr Genth, haben Sie vielen Dank für das Gespräch!
- Persönliches Interview mit Stefan Genth am 30. Juli