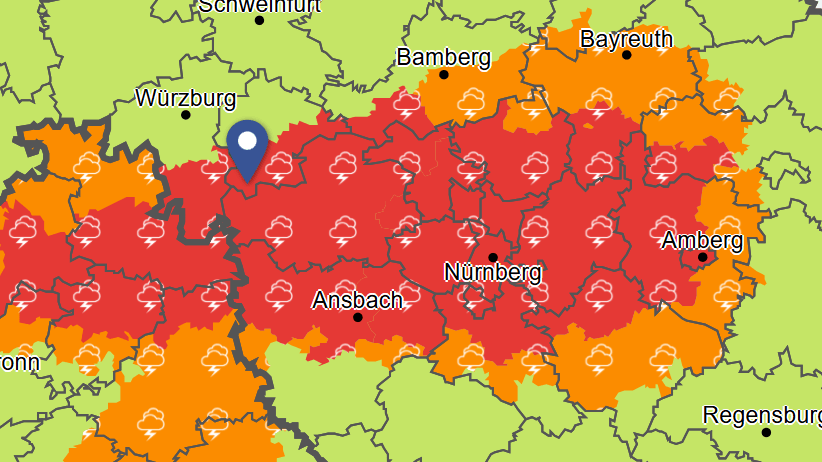Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Bedrohte Leitwährung Diese Kandidaten könnten den Dollar ablösen


Welches Geld regiert künftig die Welt? Noch ist es der US-Dollar. Doch verschiedene Interessengruppen wollen das ändern.
Der US-Dollar ist Weltleitwährung seit 1944. Weil die USA schon damals die wichtigste und größte Volkswirtschaft der Welt waren. Das bedeutet: Rohstoffe wie Öl oder Edelmetalle wie Gold werden in US-Dollar gehandelt. Auch rund die Hälfte aller internationalen Zahlungen wird in US-Dollar beglichen.
Entsprechend wichtig ist auch der Finanzmarkt: US-Aktien bringen fast die Hälfte aller Börsenwerte weltweit auf die Waage und ähnlich wichtig und gewichtig ist der US-Anleihenmarkt. Rund 40 Prozent aller Anleihen weltweit werden dort gehandelt. Und last but not least: Notenbanken weltweit haben ihre Reserven vorwiegend in Dollar angelegt.
Bei all diesen Fakten: Welche andere Währung sollte dem gewachsen sein und den Dollar als wichtigstes Geld der Welt ablösen? Aktuelle Antwort: keine. Doch die Perspektiven sind durchaus gegeben. Denn einige Volkswirtschaften haben eine eigene Währung im Visier. Aber welche kann das sein? Und was ist Vision und was könnte einmal Wirklichkeit werden?
Das Vertrauen in die USA schwindet
Die Diskussion darüber wird lauter, je schwächer der Dollar im Zuge der undurchsichtigen Zollpolitik der Regierung Trump wird und je mehr das Vertrauen in die USA als wirtschaftspolitischer Partner, als stabiler und sicherer Hafen und finanzpolitische Instanz wankt. Und so werden einige Kandidaten als Ablösewährung diskutiert. Gehen wir sie mal durch.
BRICS wollen eigene Währung – aber wie?
Nummer 1 – BRICS. Der Staatenverbund BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) stellt ganz klar die Vormachtstellung des Westens infrage, politisch wie wirtschaftlich – und das auch im Hinblick auf die Währung. Eine eigene, gemeinsame Währung ist da Teil des Plans – als Gegengewicht zum Dollar, als Symbol einer neuen Weltordnung. Und die Staaten bringen durchaus etwas mit.
Die BRICS-Staaten haben zusammen über 40 Prozent der Weltbevölkerung und rund 25 % des globalen BIP (Bruttoinlandsprodukt), Tendenz steigend. Der Verbund will nicht nur wirtschaftlich wachsen, sondern auch eine neue internationale Finanzordnung schaffen. Die Idee: Eine neue BRICS-Währung könnte den Dollar im internationalen Handel (z. B. im Ölgeschäft) ablösen, die Länder unabhängiger von der US-Zinspolitik machen und helfen, politische Sanktionen zu umgehen. Russland dürfte es freuen.
Doch wie realistisch ist dieses Projekt? Erst einmal: Obwohl sie viele gemeinsame Interessen haben, ist der BRICS-Verbund ökonomisch, politisch und währungspolitisch extrem unterschiedlich. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Zwei Beispiele: China ist wirtschaftlich trotz aller Probleme stark, Länder wie Südafrika oder Äthiopien (das zum erweiterten Kreis der BRICS+ zählt) sind es nicht. Beispiel China und Indien: Beide sind Rivalen – militärisch wie wirtschaftlich. Indien wird immer stärker, ist ein neuer Riese in der Region. Aber das ist längst nicht alles.
Ein großes Hindernis: Es gibt keine gemeinsame Zentralbank, die sicherstellen könnte, dass eine künftige gemeinsame Währung stabil wäre, es gibt keine gemeinsame Fiskalpolitik, keine rechtlich verbindlichen Mechanismen – alles Voraussetzungen für eine tragfähige Währung. Zudem ist das Vertrauen in viele BRICS-Währungen – etwa den Rubel oder den südafrikanischen Rand – nun, sagen wir: gering. Wie will man darauf etwas Stabiles aufbauen?
Das braucht Zeit, Vertrauen – und Koordination. Die fehlt. Der BRICS-Bund hat viel zu gegensätzliche Interessen in Wirtschaft und Politik, als dass da tragfähige Gemeinschaftslösungen in Sicht wären. Spätestens beim Geld hört die Bündnis-Freundschaft schnell auf.
Fazit: Viel Vision, wenig Realismus – vorerst
Die BRICS-Staaten sind sich in einem Punkt aber einig: Die Welt soll nicht länger vom Dollar abhängig sein. Doch der Weg zu einer eigenen Leitwährung ist steinig – und derzeit eher geopolitisches Wunschdenken als ökonomische Realität. Ohne Plan, einheitliche Geldpolitik und Vertrauen bleibt eine BRICS-Währung auf absehbare Zeit eine Vision. Schauen wir weiter.
Option Yuan?
Nummer 2: Chinas Yuan. Schon eine ernst zu nehmende Option. China gewinnt handelspolitisch, geopolitisch und militärisch an Einfluss in der Welt. Für China spricht seine Position als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auch seine Rolle als globaler Handelspartner und mehr bilateraler Handel in Yuan zum Beispiel im Handel mit Russland oder bei Infrastrukturprojekten entlang der "Neuen Seidenstraße" sprechen dafür. China schafft dort mit Geld und Krediten viel Einfluss und hohe Abhängigkeiten.
Unübersehbar auch: China schließt immer mehr Handelsabkommen, und wo etwa die EU investieren will oder Partner sucht, wie in Afrika oder Lateinamerika, ist China schon da. Viele Schwellenländer sind Chinas Handelspartner und sehen im Yuan eine Alternative zum teuren Dollar. Und so schließt China Währungsabkommen mit Staaten, die sich vom Dollar unabhängig machen wollen. Doch es gibt Hürden.
Eine ganz große: Anders als der US-Dollar ist der Yuan nicht frei konvertierbar. Das heißt: Chinas Regierung greift immer wieder ein, um den Wechselkurs zu anderen Währungen zu kontrollieren. Die Zentralbank nennt das einen "gesteuerten freien Wechselkurs". Für internationale Investoren ist das ein Unsicherheitsfaktor.
Ein weiterer Knackpunkt ist die nicht unabhängige Justiz; fehlende Rechtssicherheit verunsichert aber Investoren. Auch geopolitische Spannungen wirken nicht vertrauenerweckend auf Kapitalgeber.
Fazit: Viel Symbolik, aber (noch) kein Durchbruch
Aber ja, der Yuan gewinnt international an Bedeutung, der Weg zur echten Weltleitwährung ist aber weit. Das geht nur mit Reformen, Marktöffnung und Vertrauen. Da ist noch viel zu tun, aber mittel- bis langfristig kann da etwas gehen.
- Lesen Sie auch: Trump hilft ungewollt dem Dax (Kolumne)
- Flickenteppich EU: Welche Länder mit dem Euro bezahlen – wer sich weigert
Euro, die ewige Nummer 2
Nummer 3: der Euro. Der Euro ist heute nach dem Dollar auf Platz 2 der meistgenutzten Wahrungen der Welt. Er wird in rund 20 Prozent der weltweiten Devisenreserven gehalten – aber deutlich hinter dem Dollar mit fast 60 Prozent.
Der Euro hat bei aller Reichweite einen großen Schwachpunkt: die fehlende politische Einheit hinter der Währung. Die EU ist ein Staatenverbund aus 27 Volkswirtschaften mit teils ziemlich unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen. Und Krisen – wie die Euro-Schuldenkrise 2010–2012 – haben gezeigt, wie fragil das alles ist, wenn die politischen Lager keine gemeinsame Linie finden. Und dann auch noch drohen, siehe Griechenland, die EU und den Euro zu verlassen, wenn nicht alles nach ihrem Willen läuft. Das hat damals auch Vertrauen an den Kapitalmärkten gekostet und den Euro sehr geschwächt.
Nächster Kritikpunkt: keine gemeinsame Fiskalpolitik – etwa in Form einer zentralen europäischen Finanzbehörde. Das schwächt den Euro und ist ein Ausschlusskriterium auf dem Weg zur Leitwährung. Nicht zuletzt ist Europas Rolle in geopolitischen Fragen begrenzt. Die EU verfügt weder über vergleichbare militärische Schlagkraft noch über die außenpolitische Macht wie die USA – und auch nicht über Einigkeit.
Trotzdem: Der Euro hat sich etabliert. Hat Krisen überstanden. Und ganz wichtig: Er steht für geldpolitische Unabhängigkeit. Die EZB mag in letzter Zeit Fehler gemacht haben, aber sie ist solide und unabhängig. Auch deshalb wird der Euro als verlässliche Alternative zum Dollar gehalten, weltweit.
Fazit: Stabil, aber ohne Rückendeckung
Der Euro ist eine stabile Währung mit globaler Reichweite. Doch zur echten Weltleitwährung fehlt ihm die politische Rückendeckung, die geopolitische Durchsetzungskraft und einheitliche Fiskalstrukturen. Ohne all das bleibt der Euro wohl eine bedeutende Zweitwährung – akzeptiert, aber nicht führend.
Der Dollar bleibt König – noch
Und so bleibt am Ende der Dollar übrig. Derzeit auch aus guten Gründen: Die US-Finanzmärkte setzen die Standards in der Welt. Noch haben die USA eine unabhängige Notenbank, auch wenn US-Präsident Trump dem entgegenwirkt und einen Notenbank-Chef haben will, der nach seiner Pfeife tanzt. Die USA haben ein funktionierendes Rechtssystem. Noch. Das ist ungemein wertvoll. Und sollte nicht verspielt werden.
Der Dollar ist nicht nur eine Währung, sondern auch ein geopolitisches Instrument. Die USA können durch Sanktionen (z. B. gegen den Iran oder Russland) Kapital als Hebel ihrer Außenpolitik nutzen. Sie sind weiterhin die größte Volkswirtschaft der Welt und arbeiten mit sehr hoher Produktivität – alles Faktoren, die Vertrauen in ihre Währung schaffen – und nicht überall zu finden sind.
Aber: Die US-Staatsverschuldung liegt bei über 34 Billionen Dollar – Tendenz steigend. Kein Land der Welt hat mehr Schulden. Die Wirtschaft schwächelt durch Zölle und Unsicherheit. Zwar gilt der Dollar weiterhin als sicher, aber das Vertrauen ist angeschlagen und kurzfristig fließt viel Geld und Vertrauen in den Euro. Und die Welt bewegt sich. Die Währungsordnung könnte sich neu ausrichten – mit dem Euro, dem Yuan oder sogar einer BRICS-Währung als Gegenpart. Ausgeschlossen ist das nicht mehr.
- Eigene Meinung