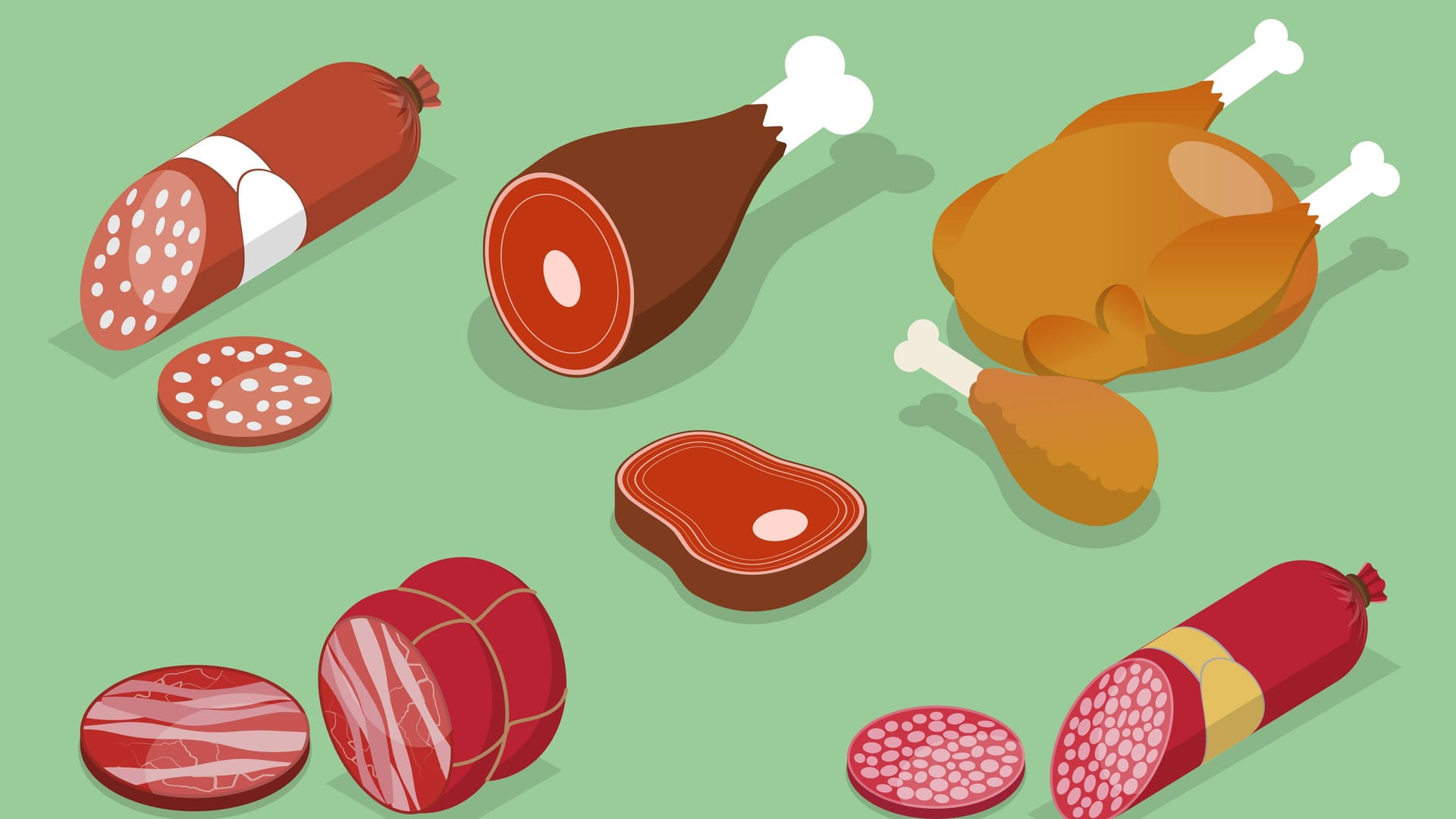Top-Ökonom Hans-Werner Sinn Der Mann und die Milliarden-Bombe
Vor gut einem Jahr entdeckte Hans-Werner Sinn ein gigantisches Risiko in der Bilanz der Deutschen Bundesbank. Seitdem kämpft der Ökonom dafür, das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Doch das Problem ist zu sperrig für eine Talkshow. Sicher ist: Das Risiko steigt weiter.
Tipp vom alten Bundesbank-Chef
Der entscheidende Hinweis kam von jenem Mann, dessen Unterschrift die D-Mark-Scheine zierte: Der ehemalige Bundesbank-Chef Helmut Schlesinger machte den Münchener Ökonomen Hans-Werner Sinn auf einen seltsamen Posten in der Bundesbankstatistik aufmerksam: Ende 2010 waren dort Forderungen von mehr als 300 Milliarden Euro an andere Notenbanken des Euro-Systems verbucht. Sinn wunderte sich - und begann zu recherchieren. Was er herausfand, übertraf seine schlimmsten Erwartungen.
"Am Anfang hatte ich ja auch nur diese Zahl und wusste nicht so recht, was sie bedeutet", erinnert sich Sinn, der als Präsident das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo führt. "Die Bundesbank sagte mir, das seien irrelevante Salden. Aber das hat mich nicht beruhigt." Er sprach mit Fachleuten bei den verschiedenen Notenbanken und mit Kollegen aus der Wissenschaft. "Jeder wusste ein bisschen was", sagt Sinn, "ich musste mir das Bild zusammenpuzzeln. Das war richtige Detektivarbeit."
500 Milliarden Risiko für Deutschland
Nach Wochen hatte Sinn ein Bild zusammengefügt, das den Betrachter erschauern lässt: Innerhalb des eigentlich harmlosen Zahlungsystems zwischen den Notenbanken der 17 Euro-Länder haben sich seit Beginn der Finanzkrise 2007 gewaltige Ungleichgewichte aufgebaut: Während die europäischen Krisenstaaten Italien, Spanien, Irland, Portugal und Griechenland Defizite von insgesamt mehr als 600 Milliarden Euro aufweisen, sind die Forderungen der Bundesbank mittlerweile auf 498 Milliarden Euro gestiegen.
Solange die Währungsunion weiter besteht, ist das noch keine Katastrophe. Das Geld ist virtuell, es wird von den Notenbanken geschaffen, ohne dass es an anderer Stelle fehlt. Doch sobald ein Land austritt oder die Euro-Zone sogar ganz zerfällt, wird es brenzlig. "Wir sitzen in der Falle", sagt Sinn. "Wenn der Euro zerbrechen sollte, haben wir eine Forderung von fast 500 Milliarden Euro an ein System, das es dann nicht mehr gibt." 500 Milliarden Euro - das ist mehr als das anderthalbfache des Bundeshaushalts und deutlich mehr als alle Risiken, die alle Euro-Staaten zusammen bisher bei der Rettung der Währungsunion eingegangen sind.
Eurozone aus den Fugen
So viel steht allerdings nur im schlimmsten Fall auf dem Spiel, etwa wenn der Euro komplett zerbricht. Wesentlich realistischer ist dagegen ein Austritt eines Landes, zum Beispiel Griechenlands. In diesem Fall müssten alle anderen Notenbanken gemeinsam die Schulden der griechischen Notenbank tragen. Die Bundesbank wäre gemäß ihrem Anteil an der Europäischen Zentralbank (EZB) mit rund 28 Prozent dabei. Bei 108 Milliarden Euro griechischer Verbindlichkeiten wären das etwa 30 Milliarden Euro.
Sinn liebt die Provokation. Doch man glaubt ihm, dass er sich in dieser Sache ernsthaft Sorgen macht. Er sitzt in einem Restaurant im Berliner Regierungsviertel. Auf dem Tisch hat er seinen Laptop aufgeklappt. Mit dem unteren Ende seines Kaffeelöffels zeichnet er die gelben und blauen Linien nach, die sich über den Bildschirm schlängeln. Sie sollen zeigen, wie sehr die Euro-Zone aus den Fugen geraten ist. "Das ist gefährlich", sagt Sinn, und seine Augen blitzen. Durch die Forderungen an die anderen Notenbanken sei Deutschland erpressbar geworden. "Jeder weiß jetzt, dass wir den Euro retten müssen - und zwar um fast jeden Preis."
Die Öffentlichkeit ignoriert das Risiko
Das klingt dramatisch. Und doch ist es Sinn bisher nicht gelungen, eine breite Öffentlichkeit für das Problem zu sensibilisieren. Nur langsam wächst das Thema aus den wirtschaftswissenschaftlichen Fachzirkeln heraus. In die großen seriösen Zeitungen hat er es zwar geschafft. Doch bis die "Bild"-Zeitung Sinns Entdeckung auf ihre Titelseite hebt, wird es wohl noch ziemlich lange dauern.
Dabei ist Sinn eigentlich alles anderes als zimperlich, wenn es darum geht, sich Gehör zu verschaffen. In Talkshows ist er auch deshalb gern gesehener Gast, weil er griffige Thesen formuliert und markige Sprüche klopft. Doch bei diesem Thema funktioniert das einfach nicht. Es ist zu komplex für die Talkshow. Hinzu kommt der sperrige Name: Target2 nennt sich das Zahlungsystem zwischen den Notenbanken. Das klingt ungefähr so spannend wie ein Seminartitel für Finanzbuchhalter.
Ausgleich für Kapitaltransfers in Europa
Eigentlich sollte das System genau so harmlos sein, wie es klingt. Es sollte dazu dienen, die Zahlungsforderungen zwischen den Notenbanken abzuwickeln, die bei jeder grenzüberschreitenden Überweisung im Euro-Raum entstehen. Solange die Wirtschaft im Gleichgewicht ist und Waren und Geld in alle Richtungen hin und her fließen, gleichen sich die Salden dabei immer wieder aus. Selbst wenn ein Land mal mehr Güter importiert als exportiert, finanziert es diese Lücke in der Regel durch Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. Auch dann sind die Target-Salden bei oder nahe null - so wie es bis Anfang 2007 der Fall war.
Ein Beispiel: Ein griechisches Unternehmen kauft bei einer deutschen Firma einen Lastwagen. Dazu überweist die Hausbank der Firma in Thessaloniki das Geld an die Hausbank in Stuttgart. Weil die Zahlung über die Zentralbanken läuft, entsteht dabei im Target2-System eine Verbindlichkeit der griechischen Notenbank gegenüber der Europäischen Zentralbank, umgekehrt erhält die Deutsche Bundesbank eine Forderung in gleicher Höhe gegenüber der EZB.
Kapitalflucht aus den PIGS-Ländern
Der Saldo gleicht sich aus, wenn entweder Geld oder Waren von Deutschland nach Griechenland fließen. In den vergangen Jahren war es meistens eher Geld. Die griechische Geschäftsbank lieh sich das Geld, das sie für den Kredit an das griechische Unternehmen brauchte, zum Beispiel bei einer deutschen Bank.
Das ist schon für sich genommen ein Problem: Weil Länder wie Griechenland, Spanien oder Portugal seit Jahren mehr im- als exportieren, waren sie schon vor der Krise auf Kapitalzuflüsse aus dem Ausland angewiesen, um die von ihnen gekauften Güter und Dienstleistungen zu bezahlen. Deutschland hingegen erwirtschaftet stetige Exportüberschüsse und muss deshalb Kapital exportieren.
Kredite aus dem Nichts in Athen
Solche Ungleichgewichte sind selbst in besseren Zeiten auf Dauer schwierig. In einer Finanzkrise können sie sogar zur Katastrophe führen, weil die Geldflüsse zwischen den Banken plötzlich stocken. So geschah es seit 2007:
- Die Banken in allen Euro-Staaten mussten ihr Geld zusammenhalten. Sie zogen sich aus vermeintlich unsicheren Ländern zurück. Auslaufende Kredite wurden nicht mehr verlängert.
- Hinzu kam die Angst der Reichen: Aus Sorge, ihr Geld könnte bald nichts mehr wert sein, schafften sie es erst aus Griechenland, Irland und Portugal heraus, später auch aus Spanien und Italien. Den Banken dort blieben weniger Spareinlagen, die sie als Kredite weiterreichen konnten.
- All das führte dazu, dass in Griechenland und den anderen Krisenländern nicht mehr genügend Geld da war, um all die Importe zu finanzieren. Wollten griechische Banken weiter Kredite vergeben, um den Kauf zum Beispiel deutscher oder holländischer Produkte zu bezahlen, mussten sie es sich bei ihrer Zentralbank leihen.
- Die Zentralbank wiederum schöpft das Geld einfach aus dem Nichts - und stellt es dem gesamten Euro-System als Target-Forderung in Rechnung. "Diese Länder ziehen das Geld einfach aus der Druckerpresse", schimpft Sinn.
Darlehen trotz mangelnder Sicherheiten
Mehr noch: Bei den Sicherheiten, die die Zentralbanken für ihre Kredite an die Banken verlangen, sind sie immer laxer geworden. Wurden früher nur Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität akzeptiert, dürfen mittlerweile auch zweit- und drittklassige Papiere eingereicht werden. Das schlägt sich auch in den Statistiken nieder: Allein zwischen 2005 und 2010 hat sich das Volumen der notenbankfähigen Sicherheiten von acht auf 14 Billionen Euro erhöht - seitdem dürfte es weiter gestiegen sein.
Gerade die Banken in Krisenländern, die ohnehin am Tropf ihrer Notenbanken hängen, reichen dabei auch noch die schlechtesten Sicherheiten ein. Griechische Finanzinstitute etwa haben vor allem Staatsanleihen ihres Heimatlandes in ihren Geschäftsbüchern. Auf dem freien Markt will solche Papiere niemand haben, doch die griechische Notenbank akzeptiert sie weiterhin als Sicherheit - und gibt im Gegenzug frisches Geld an die Banken aus. "Der private Geldfluss wird durch öffentlichen ersetzt", sagt Sinn.
Keiner will auf Sinn hören
Gefährlich wird das, wenn die Sicherheiten irgendwann einmal eingesetzt werden müssen, etwa wenn Griechenland aus der Währungsunion austritt und Bankrott anmeldet. Dann sind griechische Anleihen nichts mehr wert - und die Wahrscheinlichkeit, dass die griechische Notenbank ihre Schulden gegenüber dem Euro-System zurückzahlen kann, ist äußerst gering.
Am Anfang hat Sinn viel Kritik für seine Thesen einstecken müssen. In der Fachwelt gab es einen kleinen Aufschrei, als er sie zum ersten Mal ausführlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte - auch, weil nicht alle Gedanken so sauber formuliert waren, wie es im aktuellen Arbeitspapier der Fall ist. Er übertreibe und spiele die Risiken künstlich hoch, lautete ein Vorwurf von Kollegen. Auch die Bundesbank selbst tat die auseinanderdriftenden Salden zunächst als mehr oder weniger harmlos ab. Sinn stand ziemlich alleine da.
Jetzt erst stimmt die Fachwelt zu
"Alle dachten: Wenn das nur einer sagt, dann kann es ja nicht stimmen", erinnert sich der Ökonom. Er selbst habe aber nie an seiner Interpretation gezweifelt. Heute ist die Kritik weitgehend verstummt. "Ich habe mich zwei Wochen mit dem Thema beschäftigt", sagt ein deutscher Wirtschaftsprofessor. Dann habe er festgestellt: "Herr Sinn hat Recht. Die Analyse ist brillant." Andere geben eher zähneknirschend zu, dass das Risiko hinter den Target-Salden offenbar doch höher ist als sie anfangs glaubten.
Die Europäische Zentralbank bestätigt Sinns Analyse mittlerweile im Grundsatz, zieht aber zumindest öffentlich deutlich harmlosere Schlüsse daraus. Dass das Notenbankgeld innerhalb des Euro-Systems so ungleich verteilt ist, fördere sogar die Stabilität, da so finanziell solide Banken auch "in Ländern mit finanziellen Spannungen" ihren Liquiditätsbedarf decken könnten.
Das klingt allerdings nur beim ersten Hinhören beruhigend. Denn es heißt im Klartext: In den europäischen Krisenländern sind die Geschäftsbanken auf das Geld ihrer Notenbanken angewiesen, weil sie sonst keines mehr bekommen.
Sinn fordert strengere Regeln
Welche Chance hat ein Phänomen, bei dem selbst Volkswirtschaftsprofessoren zwei Wochen zum Begreifen brauchen, jemals in einer Talkshow-Demokratie zum Thema zu werden? Doch nur weil ein Problem komplex ist, wird es nicht automatisch weniger wichtig.
Ebenso schwer fällt eine Antwort darauf, wie sich das Risiko wieder reduzieren lässt, ohne dabei die Euro-Zone ins Chaos zu stürzen. Denn genau das würde passieren, wenn man die Notenbanken der Krisenländer von heute auf morgen zwingen würde, ihre Schulden zu bezahlen. Sinn plädiert dafür, die Anforderungen an die Sicherheiten zu erhöhen, mit denen sich die Banken das Geld bei den Notenbanken leihen. Mittelfristig könne man die Notenbanken dann zwingen, ihre Verbindlichkeiten regelmäßig mit werthaltigen Papieren zu begleichen, ähnlich wie es im US-System der Notenbank Federal Reserve üblich ist.
Eine andere Möglichkeit, das Risiko der Notenbanken zu reduzieren, wäre eine Verlagerung der Hilfen von der Geldpolitik auf die Fiskalpolitik: zum Beispiel durch die Einführung von Euro-Bonds. Doch davon will Sinn lieber nichts wissen. Er plädiert für härtere Methoden: "Die Regeln müssen strenger werden", sagt er. "Und wer es nicht schafft, sie einzuhalten, gehört nicht in die Euro-Zone." Da ist er wieder: Sinn, der Provokateur.